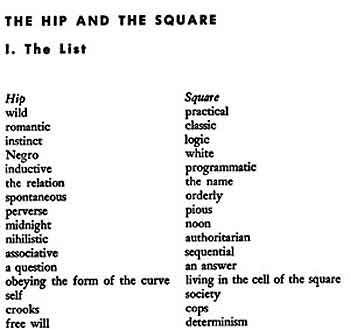Ungefähr 164 Vorwörter
Den vorliegenden Text zu notieren und zu veröffentlichen, entstammte einem spontanen Impuls. Erste Fassungen waren bedeutend kürzer. Trotz zahlreicher späterer Ergänzungen und Ausgestaltungen bin ich bei einer Schilderung meiner Erfahrungen, Wahrnehmungen und Darstellungen aus dem Fundus entsprechender Reflexionen geblieben. Wie auch immer geartete Ansprüche an Wissenschaftlichkeit habe ich mir nicht gestellt. Der Text ist auch insofern ein reiner Essay.
Obwohl es ist mir nicht wichtig ist, ihn irgendwo anders als auf meiner Home Page veröffentlicht zu sehen, steht es selbstverständlich Jedem frei, gegebenenfalls (mit Quellenangabe) daraus zu zitieren. Falls es sich dabei um eine Internet-Veröffentlichung handeln sollte, würde ich darauf Wert legen, daß ein Link¹ gesetzt wird, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, den Quellentext nachzuvollziehen. Sogenannte Back-Links können ggf. gern mit mir abgesprochen werden. Entsprechendes gilt für den Print-Bereich - hier sollte eine Fußnote o. ä. auf die Quelle verweisen. Bei Zitaten, die über das hier von mir veröffentlichte Wort hinausgehen, möchte ich in jedem Fall um Autorisierung gefragt werden.
¹ Link-URL: www.johannesschaedlich.de/text_akquise.html
* * *
Zur Arbeitsweise im organisatorischen Umgang mit Bewerbungen (u. a. mit
Vorschlägen für Veranstalter) - und Kommunikation
Die Kommunikation zwischen Veranstaltern und Musikern zu thematisieren, ist aus meiner Sicht lohnend und zumindest im Hinblick auf die folgenden Themenaspekte längst überfällig.
Einige Änderungsvorschläge sollen im Weiteren nicht fehlen, ebensowenig wie ein paar Worte aus meiner persönlichen Sicht zu Gründen und Hintergründen.
Ich möchte als grundlegenden Gesichtspunkt voranstellen, daß die Kommunikation zwischen Veranstalter und Musiker für beide Seiten offenbar nicht dieselbe Wichtigkeit und entsprechende Bedeutung hat.
Betrachten wir eine Kontaktaufnahme „von Musiker zu Veranstalter“ - zunächst als einzelnen Vorgang: es liegt in der Natur der Sache, daß ein Musiker sich mit dem Beginn seiner Bewerbung auf eben diesen Veranstalter konzentriert, der seinerseits jedoch gleichzeitig mit mehreren Angeboten der Spezies konfrontiert ist.
Logischerweise wird es für einen Musiker in entsprechendem Grade schwieriger, sein Angebot darzustellen, je reichhaltiger die einem Veranstalter derzeitig zur Verfügung stehende Auswahl eben beschaffen ist. Zu einem Vertragsabschluß ist es somit noch ein recht weiter Weg.
Wir beide haben also in der besagten Art von Bedeutung und „essentieller Wichtigkeit“ der Kommunikation miteinander deutlich unterschiedliche Perspektiven, um nicht zu sagen Positionen, da wir allerseits mit einem geradezu inflationären (Über-)Angebot von Musik bei sukzessivem Rückgang von Auftrittsmöglichkeiten und auf Veranstalterseite einem oft prekären Mangel an Zeit und Personal konfrontiert sind.
Man wird Verständnis haben, wenn ich hier der Betrachtung aus Musiker-Perspektive zunächst den Vorrang gebe.
Musiker könnten ja nach einschlägigen Erfahrungen in Sachen Auftritts-Akquise irgendwann einmal, sagen wir: ziemlich abhärtet sein. Nach meiner Erfahrung ist es jedenfalls hilfreich, falls man nicht von der Natur mit entsprechendem Talent begabt sein sollte, sich beizeiten eine gewisse Robustheit zuzulegen. Viele Kollegen würden wohl hinzufügen, das sei, nicht nur einfach hilfreich, sondern sozusagen ein unverzichtbarer Bestandteil des geistigen Rüstzeuges. Vielleicht können sie mit alldem umgehen, vielleicht geben sie frustriert auf - was so jedenfalls auch nicht selten vorkommt; diverse kurzfristige Präsenzen gewisser Bands und Musiker in der Art von „Strohfeuern“ (zumindest innerhalb der Jazz-Szene) lassen sich sicherlich so erklären. Darum geht es hier jedoch nicht.
Fangen wir mit einigen Erfahrungen aus der Praxis an.
Zu Beginn seiner Laufbahn als Band-Manager erhebt sich für einen Musiker zum Beispiel die Frage, ob es günstiger ist, einem bestimmten Veranstalter erst eine Mail zu senden und dann anzurufen oder umgekehrt. Und die Frage, wie man das herausfindet - denn Mails und Post werden selten zeitnah beantwortet und den telephonischen Kontakt aufzunehmen ist in recht vielen Fällen nicht ganz einfach.
Eine Mail ohne Anruf bewirkt in aller Regel so gut wie nichts. Einfache E-Mail-Kampagnen hatten vielleicht vor Jahren einmal irgendeinen Effekt, sind aber seit Langem praktisch nutzlos geworden - man kann den Eindruck gewinnen, einem Veranstalter eine Mail zu senden sei kaum hilfreicher, als ihm zum Beispiel eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter zu hinterlassen (diese Geräte existieren in vielen Büros, haben jedoch für die Kommunikation mit Musikern nicht viel mehr als einen abstrakten, eher symbolischen Wert).
Auf dem Server treffen zahlreiche, bisweilen zahllose E-Mails ein, stapeln sich und bleiben oft ungelesen.
Vielleicht kommt es vor, daß mit der Größe des Stapels unbeantworteter Mails bei manchem Veranstalter auch ein (wohl eher unbewußtes) schlechtes Gewissen heranwächst, das wiederum die Bearbeitung des Mail-Stapels erst recht verhindert. Darüber weiß ich natürlich nichts. Man bindet es mir schließlich auch nicht auf die Nase.
Was ich aber in Gesprächen schon mitbekommen habe, ist, daß viele Veranstalter solche Mail-Anschreiben, die ihr Interesse erwecken, erst einmal in einen Ordner einsortieren, um sie zur Planung der nächsten Spielzeit noch einmal aufzurufen. Dasselbe trifft für Adressen von Home Pages zu, die als Lesezeichen („Bookmarks“) in einem entsprechenden Ordner gespeichert werden. Was mit dem Rest passiert, weiß ich nicht - kann mir aber vorstellen, daß er zum Beispiel in logischer Konsequenz gelöscht wird.
Der entscheidende Punkt dabei ist, daß der Musiker in aller Regel von alldem nichts mitbekommt. Er kann ja nicht ahnen, was mit der Mail passiert ist; ob sein Angebot Interesse gefunden hatte und wann der nächste Zeitpunkt der Programmplanung des jeweiligen Veranstalters ist. Das findet er (der Musiker) nur dadurch heraus, daß er anruft. Also setzt er den Vorgang auf seiner Wiedervorlage-Liste. Und die wächst im Handumdrehen auf sechzig, achtzig Adressen an - oft sind es bedeutend mehr. Man kann nun bereits ahnen, in was für eine Arbeit das Ganze mündet, nicht wahr?
An der Organisation eines einzigen Auftrittes hängt immer ein Rattenschwanz von Aufgaben - auf Seiten aller Beteiligten. Bis dieser Termin unter Vertrag ist, sind im Hintergrund diverse Gespräche, Mails, Post und alle möglichen anderen organisatorischen Dinge abgelaufen und das dürfte, wie gesagt, ein recht weiter Weg gewesen sein.
Außer den beiden unmittelbar Beteiligten - dem Musiker/Band-Manager und dem Veranstalter bekommt davon kaum jemand etwas mit. Meistenteils auch nicht die Band-Kollegen - und natürlich haben Außenstehende erst recht keinen Schimmer von diesem Geschäft. Man kann das selbstverständlich, auch wenn man einmal in etwas frustrierter Stimmung sein sollte, niemandem ankreiden oder sonstwie etwa übelnehmen.
Es geht mir hier vor allem darum, hervorzuheben, daß Musiker und Veranstalter von der Situation ihres jeweiligen Gegenübers oft nicht viel wissen.
Aus der Perspektive des Musikers wäre es schon mal eine Riesen-Arbeitserleichterung, wenn der Veranstalter, der sich für das Projekt interessiert, dies auch kund und zu wissen täte. Eine kleine Mail wie diese:
(Anrede),
haben Sie Dank für Ihre Zuschrift.
Wir finden Ihre Musik/Ihr Projekt interessant und haben Ihre Bewerbung unserem Material zur Planung der kommenden Spielzeit zugeordnet. Unser Planungsgremium wird darüber entscheiden, ob Ihre Bewerbung berücksichtigt werden kann.
Wir beginnen diese Planung etwa (Angabe des Zeitpunktes) und bitten Sie, sich dann noch einmal mit uns in Verbindung zu setzen.
Am liebsten wäre uns eine Erinnerungs-Mail an die bekannte Adresse (ggf. abweichende Mailadresse) / ein Anruf unter (Nr.) zwischen (Uhrzeit) und (Uhrzeit) an (Datum von - bis etc. pp.).
Besten Dank und freundliche Grüße -
(Name/Institution)
Ich wiederhole: eine solches - umgehendes - Antwortschreiben wäre schon mal ein Riesen-Fortschritt. Na, wie wär´s? Ist nicht zu viel verlangt, oder?
Solche oder ähnliche „Form-Mails“ könnte man sich für alle möglichen weiteren Angelegenheiten entwerfen und abspeichern, sodaß man dem Bewerber mit nicht viel mehr Aufwand als copy and paste eben mal fix antworten kann. Das oben notierte Exemplar stelle ich jedenfalls hiermit zur Verfügung - copy and paste!
Übrigens habe ich zum selben Zweck ein Kontakt-Formular (mit Check-Boxen usw.) entworfen und auf meiner Home Page zur Disposition gestellt (hier ist der Link). Das bietet Veranstaltern die Möglichkeit, mein Anschreiben mit ein paar Klicks und evtl. ein paar Worten super-schnell und konkret zu beantworten. Es ist ein Experiment; ich bin gespannt, welchen Zuspruch es findet.
Manche Musiker versuchen, mit Mails in reichhaltiger Ausstattung zu beeindrucken - manche versenden gar Soundfiles im Anhang. Ungefragt Anhänge zu senden sollte man jedoch lieber unterlassen - mit solchen Mails von mir unbekannten Absendern würde ich mich übrigens auch nicht abgeben. Sie bleiben ohnehin oft unmittelbar in Spam-Filtern hängen und machen ansonsten in praktisch jedem Fall einen schlechten Eindruck. Bei dem immensen Aufkommen von Spam (Müll) sind solche Filter ja auch gut und notwendig - die meisten funktionieren mittlerweile relativ angemessen.
Ein Bild einzufügen geht gerade noch - falls es nicht zu groß ist. Die zur Darstellung von Bildern u. ä. im Web übliche Auflösung beträgt 72 dpi; eine Datenmenge von ca. 300 kB zu überschreiten würde ich nicht empfehlen (das ergäbe in einer Mail auch ein bereits ziemlich großes Bild). Wie dem auch sei: letztlich kann nur der telephonische oder persönliche Kontakt - unter Umständen - irgendetwas bewirken.
Allein der Teil der Arbeit, diesen Kontakt zum Veranstalter herzustellen, kann Wochen beanspruchen, denn die telephonische Erreichbarkeit von Veranstaltern im Jazz-Bereich stellt sich als ziemlich schwierig dar: man erreicht hier einmal Jemanden nur vormittags, dort nachmittags bis Büroschluß, wieder Andere haben ihre Zeiten kurz danach oder am frühen Abend, das Ganze nur an bestimmten Wochentagen und so weiter. Diese Zeitfenster sind also auf einer auch nur durchschnittlich langen Wiedervorlage-Liste über den ganzen Tag verstreut und ich kann das alles eigentlich nicht bedienen, falls ich meinem Hauptberuf noch in erforderlicher Weise nachgehen will. Es gibt Ansprechpartner im Konzert-Business, deren uhrzeitliche Erreichbarkeit als eine Art Geheimtip gehandelt wird.
Die Fragestellung, was hier eigentlich mein Nebenberuf ist, erhebt ihr häßliches Haupt.
Aber gibt es eine Alternative zur telephonischen Kontaktaufnahme? Ich fürchte - nein, es gibt keine.
Kleine Illustration zwischendurch: von einem dieser eher monarchisch eingestellten Jazzclub-Programmgestalter habe ich - es ist bereits einige Zeit her - einmal gehört: „Du bist kein Amerikaner, Du bist nicht schwarz und Du hast keine Sängerin in Deiner Band - wieso rufst Du mich eigentlich an?“
Es will mir scheinen, daß ein bedeutender Teil der Gesamt-Problematik damit immerhin sehr pointiert ausgedrückt ist. Obwohl ich mich in diesem Fall im Stillen gefragt habe, wer von uns Beiden hier eigentlich am Besten seinen Laden dichtmachen sollte, fand bzw. finde ich dennoch Gründe, weiterhin Veranstalter anzurufen. Manchmal allerdings... Um es mal vorwegzunehmen: die Jazz-Szene ist mittlerweile in einem desolaten Zustand. Ich gehe so weit, zu konstatieren, daß sie eigentlich ziemlich im Eimer ist. Dabei findet Jazz und „Artverwandtes“ seit einiger Zeit viel mehr Publikums-Zuspruch, als es über längere Zeit der Fall war. Ich werde im Folgenden noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen.
Sollte die telephonische Verbindung zustande gekommen sein, heißt es meistens, die Programmplanung sei entweder für die Saison oder dieses Jahr schon abgeschlossen oder sie habe noch nicht begonnen oder sie sei noch in der Schwebe oder was dergleichen Möglichkeiten mehr sind - „ruf in vier Wochen nochmal an“. Wenn dies dann gelingen sollte, ist es sehr oft doch schon wieder zu spät gewesen.
Klare Aussagen - selbst Absagen - sind in aller Regel schwer zu bekommen. Manche meiner Akquise-Vorgänge ziehen sich auf diese Weise buchstäblich über Jahre hin.
Schwierig kann auch der Umgang mit einigermaßen häufig angetroffenen Allüren bei Leuten sein, die mich, kaum daß ich auf den Grund meines Anrufes zu sprechen kommen konnte, in ziemlich einseitige Unterhaltungen verwickeln. Ich möchte es einmal so ausdrücken: mitunter keimt in mir bei einigen dieser Kandidaten der Verdacht - auch anhand des Tonfalls, der mir da entgegengebracht wird - daß versucht wird, zuerst einmal eine klärende Auseinandersetzung über unsere Rangordnung zu inszenieren. Immerhin habe ich, berechtigterweise oder nicht, öfters einmal die deutliche Empfindung, die Position eines Bittstellers zugewiesen zu bekommen. Ich möchte das hier erst einmal dahingestellt sein lassen und begnüge mich insoweit mit der Schilderung; klar ist in jedem Fall, daß es nicht günstig für mich wäre, das nette Gespräch insistierenderweise zu unterbrechen.
Indem ich also auf der Suche nach einer Bühne für meine Musik nolens volens zuerst einmal eine Arena zur Selbstinszenierung meines Ansprechpartners zur Verfügung stelle, lasse ich mir zum Beispiel schildern, was für große, ja illustre Namen schon auf „seiner“ Bühne gastiert haben oder auch, wieviel Hunderte von Bewerbungen wöchentlich in seinem Büro einträfen. Sich unter Schilderung des heldischen Kampfes mit der finanziell desolaten Situation des Etablissements chronologisch seit ungefähr 1978 bis heute an meiner Schulter auszuweinen ist eine weitere mögliche Variante - sie wird wahrscheinlich vorbeugend gegen die Höhe meiner Gagenforderung angewandt. Kombinationen aus diesen und anderen Varianten sind möglich, komplett alle hintereinanderweg nicht unwahrscheinlich. Gibt es außer den bereits erwähnten Beweggründen der Förderung der Selbstzufriedenheit meines telephonischen Gegenübers noch weitere, andere Zwecke einer solchen Konversation? Natürlich ist das eine rhetorische und ein wenig polemische Frage, zugegeben.
Sie dient dazu, die Darstellung eines Aspektes, eines Teils meiner Akquise-Arbeit zu illustrieren, der außer Zeit vor allem Nerven kostet.
Nun, in günstigeren Fällen erreicht man die Zusage, daß das Bewerbungsmaterial nun doch (endlich) aus dem Korb bzw. dem Stapel herausgesucht werden würde - „ich hör´s mir dann mal an“. Der Stapel kann geradezu paläolithische Warven oder andere Formationen enthalten; wenn mein Zeug irgendwo zwischen Kambrium und Quartär am Übergang zwischen Jura und früher Kreidezeit zu finden ist, fühle ich mich schon privilegiert und nahe am Ziel. Das ist naiv, wie ich wissen könnte, wenn ich darüber nachdenken würde. Vielmehr komplettieren sich die wolkigen Angaben aus den Füllwörtern „dann“ und „mal“ im weiteren Verlauf des Schicksals nicht selten um den Umstand, daß sich mein Material als zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr auffindbar erweist. Selbiges erfährt man beiläufig (dann mal) anläßlich eines weiteren, endlich geglückten Gesprächskontaktes - „schick´s mir doch nochmal vorbei“.
Vielleicht war mein erstes Infomaterial ja schon verwittert und zu Staub zerfallen. Nachdem ich den Gedanken verworfen habe, es vorsorglich in Stein meißeln zu lassen (zu hohe Versandkosten), schicke ich also die zweite Packung hinterher. Klar, daß ich nichts Besseres zu tun habe ... Und dann geht das Spiel von vorne los.
Wohl schärfe ich beständig meine telephonisch-telepathische Intuition, um in meiner charismatischen Art zumindest für den Gesprächsbeginn die auf meinen jeweiligen Ansprechpartner individuell abgestimmte Mixtur aus Super-Musiker-Gehabe und dem Zergehen in subalterner Bescheidenheit zu finden. Nein, jetzt wieder im Ernst: ich frage mich hin und wieder, ob solche Gespräche wirklich sein müssen. Von allen anderen Effekten einmal abgesehen, bringen sie schließlich die Sache, um die es gehen sollte, eher nicht so recht vorwärts.
Manchmal - und gar nicht so selten, wie man denken könnte - geben sich sogar Leute als Ansprechpartner aus, die dazu eigentlich überhaupt keine Kompetenz innerhalb ihrer Organisation haben, es aber offenbar dringend benötigen, für wichtig gehalten zu werden. Ich kenne mehrere von der Sorte - z. B. Einen, der es mit jahrelangem Hinhalten wahrhaftig zum Aufgeben der betreffenden Bewerbung brachte, bis man dann unverhofft, rein zufällig und über irgendwelche Ecken doch endlich „den richtigen Ansprechpartner“ ausfindig machen konnte. Dem war das Verhalten seines Vereinsmitgliedes offenbar bekannt - darauf angesprochen, hieß es gleich: „Ach, der! ...“ Nun half das dann auch nicht mehr viel.
Häufiger noch hat man Ansprechpartner auf der Liste, die solche Kompetenzen (vielleicht) hatten, nun aber nicht mehr haben, weil es zum Beispiel personelle Änderungen in der „Programmbeiratskommission“ gab. Es kann in allen solchen oder ähnlichen Fällen lange dauern, bis man herausgefunden hat, an wen man sich stattdessen wenden müßte.
Falls man die Stirn gehabt haben sollte, eine Tournee-Planung für seine Band ins Auge zu fassen, landet man jedenfalls organisatorisch vielerorts endgültig „in Teufels Küche“. Wenn es weiter nichts ist, als daß die Tourneeplanung zum Anlaß genommen wird, beim Thema der Gage einen gewissen Druck auszuüben, zählt das bereits zu den günstigeren Fällen.
Ich weiß natürlich auch, daß es hier viele unterschiedliche Nuancen gibt und daß es darüber hinaus diverse Veranstalter gibt, die sich völlig anders und somit völlig positiv verhalten, bin aber dennoch überzeugt, mit der vorangegangenen Schilderung nicht übertrieben zu haben.
* * *
Was ist zu tun? Zunächst wäre festzustellen, daß die Arbeitsweise der Musiker praktisch und initiativ nicht geändert werden kann, denn zum ständigen Versuch der telephonischen Kontaktaufnahme gibt es zur Zeit keine Alternative - zumindest, bis andere Kommunikationsformen effektiv genutzt werden!
Ich muß also Veranstalter anrufen, wenn ich meine musikalischen Ideen tatsächlich für ein Publikum verwirklichen, also auf Bühnen bringen will. Ach, übrigens: genau das will ich ja! Und so betrifft die Welt der Akquise nun direkt, essentiell und unmittelbar mein Dasein und Wesen als Musiker, denn ich will meine Musik ja entwickeln. Auch dazu benötigt man Auftrittsmöglichkeiten - und vor allem ZEIT! Viel von dieser wichtigen und wertvollen Zeit wird aber in der mitunter geradezu verzweifelten Akquise verschwendet und verschleudert.
Mit einer recht persönlichen Bemerkung möchte ich an dieser Stelle illustrieren, was ich eingangs mit der Erwähnung einer für Veranstalter und Musiker offenbar unterschiedlichen Wichtigkeit und Bedeutung der „Kommunikation“ meinte.
Ich gestehe, daß ich mit dem hinreichenden Maß an Durchsetzungsvermögen, das man unter Anderem zur Akquise von Auftrittsmöglichkeiten nun einmal benötigt, nicht von Natur aus begabt bin, obwohl ich im Übrigen normalerweise gut mit Leuten reden und, wenn es sein soll, auch verhandeln kann. Diesen Mangel versuche ich durch Lernen auszugleichen. Außerdem spreche ich des Öfteren mit Musikerkollegen und Veranstaltern über unsere jeweiligen Erfahrungen. Dennoch empfinde ich manchmal eine gewisse Betroffenheit, wenn ich erlebe, daß allzu oberflächliche Notiz von meinen Angeboten genommen wird. Selbstverständlich nehme ich das niemals etwa persönlich - andernfalls müßte ich mich auf etwaige Wehleidigkeit, Naivität und Weltfremdheit überprüfen. Diese Eigenschaften schreibe ich mir jedoch nicht zu. Vielmehr glaube ich, daß eine etwas ausgeprägtere Robustheit in der relativ harten Wettbewerbssituation, der ich ein Produkt aussetze, hinter welchem ich mit meiner gesamten Persönlichkeit stehe, sehr hilfreich ist.
Als ich nach einigen Jahren der recht erfolglosen Beschäftigung mit dem Geigenspiel endlich damit aufhören durfte, war ich ungefähr vierzehn und kurz darauf war mir glasklar, daß der Baß das Instrument für mich ist. Bisher habe ich daran nicht einen Augenblick gezweifelt. Ich besitze keinen ausgeprägten „Geigen-Charakter“ - hier im Sinn von „Front-Mann“ gemeint. So viel einmal dazu.
Eine Agentur, ein Konzertbüro? Schön wär´s. Insbesondere in der Jazz-Szene ist es gang und gäbe, daß ein Musiker gleichzeitig sein eigener Manager ist, denn das recht bescheidene Gagen-Niveau läßt keine ernstzunehmendes Budgets für Management-Provisionen übrig. Es ist wohl verständlich genug, daß unter diesen Bedingungen sich niemand irgendein relativ unbekanntes Projekt vom Grunde aufzubauen vornimmt. Man wird bestenfalls solche Agenten finden, die auf einen bereits fahrenden Zug aufspringen würden.
Ich bin einmal gefragt worden, ob ich nicht auch zuweilen von Veranstaltern angerufen würde. Nach einigem Überlegen konnte ich nur das bekannte Wort von den Jubeljahren zur Antwort geben. Ich hatte es bei der Gelegenheit um die Variante „Jubel-Schaltjahre“ erweitert und den Wunsch hinzugefügt, so alt zu werden, daß ich dergleichen noch einmal erleben dürfte.
Das klingt vielleicht etwas dramatischer, als ich es meine - vielmehr kommt hier ein wenig Galgenhumor zum Ausdruck. Man ist jedenfalls gut beraten, sich auch ebenden - zusätzlich zu besagter Robustheit - beizeiten zuzulegen.
* * *
Sehen wir also der Tatsache ins Auge, daß die Jazz-Szene bei steigender Tendenz stark überlaufen ist, während die oft ehrenamtlich arbeitenden Veranstalter mit der Arbeit nicht nachkommen. Wo ist die Lösung? Musiker können naturgemäß das Aufkommen von Bewerbungen nicht reduzieren (sonst müßten sie sich ja irgendwie selbst reduzieren). So unausgewogen es klingen mag: die Methoden müssen zunächst auf Seiten der Veranstalter geändert werden.
Erstens: reagieren, antworten. Das Thema hatte ich weiter oben bereits angesprochen und einen Text für eine Antwort per Mail vorgeschlagen. Im Folgenden finden sich dazu weitere Anregungen.
Zuvor möchte ich auf ein in diesen Zusammenhang gehöriges Spezialthema pointiert zu sprechen kommen: Absagen.
Mein Ansprechpartner sollte mir eine Absage erteilen, wenn die angebotene Musik nicht in das Konzept des Clubs/des Etablissements paßt. Merkwürdig genug - gerade dies scheint vielfach problematisch zu sein und sich bei einigen Veranstaltern außerhalb ihres Aufgabenbereiches zu befinden, obwohl es doch eine gewisse Entlastung des Schreibtisches bedeuten müßte. Für mich ist eine Absage logischerweise ganz bestimmt und erst recht nicht wünschenswert, letztendlich aber ebenfalls eine echte Entlastung. Andernfalls habe ich, wie bereits angedeutet, für lange Zeiten Bewerbungsprojekte auf meiner Liste für „Wiedervorlagen“, die im Grunde aussichtslos und für alle Beteiligten überflüssig sind.
Schilderung: man bekommt also mal Jemanden ans Telephon, man wird mal wieder vertröstet, man hat daraufhin für weitere Wochen und Monate diese Kontaktadresse auf der „To Do“-Liste - obwohl man dort vielleicht nie spielen wird.
Aber das erfährt man nicht, denn viele Veranstalter ziehen es ja offenbar vor, zu sagen, daß man sich so ungefähr dann und dann eventuell mal wieder melden solle. Hoffen sie etwa, daß man ganz von selbst aufgibt - und eben nicht mehr anruft? Über Gründe dafür kann man nur spekulieren.
Durch diese Vertrösterei kommt es jedenfalls dazu, daß ständig eben auch solche Leute beim Veranstalter anklingeln und nachbohren, die der im Grunde garnicht im Programm haben will. Das könnte er denen doch auch mal sagen!? Dann wüßte der Musiker wenigstens, woran er ist und alle hätten weniger Streß.
Außerdem ist das organisatorisch gar nicht so schwer, wie es manchen Veranstaltern offenbar erscheint.
*
Zweitens: über das Interesse an einer Bewerbung muß im Veranstalter-Büro wesentlich effektiver und zügiger entschieden werden und die daraus folgende Zu- oder Absage muß unmittelbar(-er) bearbeitet werden. Man muß sich als Team also konkrete(-re) Bearbeitungsfristen setzen (sog. „Deadlines“, wenn´s halt so heißen soll). So muß im Fall von, sagen wir „gewissem Interesse“ an einer Musik die Entscheidungsfrist so zuverlässig wie möglich definiert und dies, wie schon erwähnt, dem Bewerber auch bekanntgegeben werden. Wenn eine Entscheidung innerhalb der Frist nicht zu schaffen ist, müssen die betreffenden Acts halt in den „Wiedervorlage“-Ordner als Projekte für die nächste Spielzeit gesteckt werden. Ich wiederhole: der Veranstalter sollte die Band unbedingt gleichzeitig darüber informieren, wann und für welchen Zeitraum eine erneute Anfrage bzw. eine „Memo-Mail“ sinnvoll ist. Da dies für manche Acts sicherlich mehrmals wiederholt werden muß, bis es zu einem Engagement oder einer Absage kommt, muß der Bandleader/Musiker/Manager einstweilen also wenigstens auf dem laufenden gehalten werden. Den auf diese Weise sicherlich stark anschwellenden „Wiedervorlage“-Ordner darf man aber nicht ins Uferlose wachsen lassen, sondern er muß gut organisiert werden.
Hier ist noch ein Beispiel für einen Standard-Brief - nämlich der zitierte Text einer Email vom Organisationsstab des Idsteiner Jazz-Festivals. Er enthält eine recht gut formulierte Absage an Musiker, deren Bewerbung nicht berücksichtigt werden konnte (interner Link zum Beispieltext; Anmerkung: die kleine Graphik habe ich mir erlaubt, hinzuzufügen, war im Original nicht enthalten).
Kurz gesagt: sowas kann Jeder. Länger: einen Text wie diesen könnte wohl jeder Veranstalter seinen Maßgaben entsprechend formulieren, ggf. in mehreren Versionen bereithalten und in entsprechender Form in eine eMail einfügen.
Und noch etwas, liebe Veranstalter: den zukünftigen „Spielplan“ sollte man halt auch nicht ins Uferlose wachsen lassen.
Im Moment (Anfang März 2010) habe ich zum Beispiel eine Möglichkeit, bei einem lokalen Jazzclub einen Termin für September 2011 klarzumachen - ich soll also einen „so-ungefähr-Hundert-Euro-pro-Person-Gig“ über anderthalb Jahre im Voraus organisieren und reservieren.
Ich verstehe schon - es ist schwierig, das alles unterzubringen, was man gerne im Programm haben möchte. Und dann kommt auch noch die eine oder andere interessante Band „ausgerechnet da“ auf Tour vorbei - die man dann sicherlich günstig bekommen könnte...
Und ich soll versprechen, d. h. vertraglich zusichern, daß alle Bandmitglieder an diesem Termin in mehr als anderthalb Jahren dann auch wirklich noch frei sein werden? Wer weiß - da ist inzwischen vielleicht Einer davon (oder ich selbst) bei irgendeinem „Super-Act“ in der Band gelandet und auf Tournée? Na ja, es kommen auch aus geringeren Gründen entsprechende mehr oder weniger kurzfristige Absagen vor - mit der damit verbundenen Notwendigkeit, einen „Sub“ einzubauen. In Klammern: das ist angesichts der marginalen Jazzclub-Gage nicht ganz unverständlich und kann obendrein - vor allem, wenn dafür noch Proben-Arbeit erforderlich ist - recht schwierig werden - der Bandleader hat auf jeden Fall und wie immer den „schwarzen Peter“, Klammer zu. Wir wollen ja mal das Beste hoffen, aber ich kann noch nicht einmal garantieren, daß es die Band in der Besetzung bis da hin überhaupt noch gibt (und woher sollte ich eigentlich so sicher sein, daß ich bis dah hin überhaupt noch lebe??). Stellt Euch also nur mal vor, Ihr habt die Gelegenheit, einen Jazzclub-Gig etwa anderthalb bis zwei Jahre im Voraus auszumachen - unsereinem wird da nach Galgenhumor zumute. Ist das (rational) verständlich? Oder sind wir alle irgendwie verrückt?
Nun, angesichts der Problematik samt der bei diesem Konzerttermin avisierten Gage haben meine Freundin Lindy Huppertsberg und ich am heimischen Küchentisch (und, wie gesagt: im Jahr 2010) angesichts eines für das folgende Jahr abgeschlossenen Gastspielvertrages im "Jazz-Club X" jedenfalls in der Art wie: „na, Gott sei Dank - (das kommende Jahr) 2011 ist also im Kasten. Jetzt können wir ja schon mal mit der Akquise für 2012 anfangen“ recht ausführlich gewitzelt. So viel hier mal zu "Galgenhumor"...
Zurück zum „Wiedervorlage“-Ordner eines Veranstalters - man muß den also regelmäßig entrümpeln - wie gesagt: Info-Mails an Bewerber schicken und sich häufiger zu Absagen entschließen, als das offenbar weithin der Fall ist. Die daraus folgenden Absagen müssen zeitnah verschickt werden.
Um noch ein wenig beim Thema zu bleiben: wenn man sich allein dazu entschließen würde, mehr Courage für Absagen aufzubringen, würde das allerhand Zeit sparen, die man in andere Bearbeitungsvorgänge investieren könnte.
Ob „Courage“ wirklich hinter der Problematik sozusagen fehlender Absagen steckt? Es sieht hier und da so aus. Ich kann mir vorstellen, daß man Bewerber nicht vor den Kopf stoßen möchte; eine diffuse Sorge, sich eventuell irgendwo unbeliebt zu machen, kann eine Rolle spielen - oder man ist prinzipiell unangenehm berührt, wenn man sich vor Wahlentscheidungen gestellt sieht, die erfordern, daß man „Farbe bekennt“ - ?
Es kommt offenbar auch vor, daß Veranstalter sich von entsprechend hartnäckigen Bewerbern quasi überreden lassen, sie zu engagieren. Das ist gewissermaßen weniger aufreibend, als Positionen zu beziehen. Es wäre, wenn man so will, eine Variante des „Aussitzens“.
Das sind zwar nur Vermutungen, aber es gibt in der Tat Jazz-Clubs, die in dem Ruf stehen, daß dort vor allem die hartnäckigsten Anrufer zu Gigs kommen. Ob die nun zu denen zählen, für die sowieso bereits ein gewisses Interesse bestand oder nicht, scheint nicht unbedingt jedes Mal die entscheidende Rolle zu spielen. Ich habe einen Jazzclub-Vorsitzenden schon wörtlich sagen gehört: „wer am hartnäckigsten nachfragt, hat die besten Aussichten“. Was soll denn das für eine Musik-Auswahl sein?
Zuweilen habe ich sogar den Verdacht, daß manche Veranstalter nie etwas an ihren Methoden ändern werden, weil es doch „irgendwie“ auch ein Gutes hat, wenn ständig Leute vorsprechen und Bücklinge machen ...
Nun, die Psychologie ist eine Seite; der immense Arbeitsaufwand und die begrenzte Zeit eine andere.
* * *
Über Arbeitsmethoden mit Hilfe des Internet
Manchmal möchte ich am liebsten laut und deutlich sagen: „Ihr verschwendet meine Zeit!“
Und diesem Kapitel hier gleich noch hinzufügen: „da beklagt Ihr Euch über das immense Aufkommen an Bewerbungen und klebt an umständlichen, veralteten Methoden der Bearbeitung!“
Das mußte einmal gesagt sein.
Ich hoffe, „Ihr“ recht pauschal Angesprochenen mißversteht dies nicht als polemische, polarisierende Anschuldigungen. Vorsorglich möchte ich den Hinweis wiederholen, daß es mir in erster Linie um die Verbesserung unserer Zusammenarbeit und meine Anregungen dazu geht.
Warum ich mir im Übrigen die Mühe mache (bzw. gemacht habe), diesen Text zu verfassen, erklärt sich zu einem Teil daraus, daß mein Reflexions-Potential von meinen Erlebnis-Quantitäten eine Zeitlang nicht aufgebraucht wurde. Zu weiteren Teilen erklärt es sich ja sicherlich von selbst, dazu vielleicht noch aus meinen Vor- und Nachworten und soll zu eventuell übriggebliebenen Teilen jedenfalls kein Gegenstand dieser Erörterungen sein.
*
Damit wäre ich bei „drittens“, denn es sollten ja gewisse Arbeitsweisen und -Methoden näher betrachtet werden. Sie sind - ich muß es noch einmal so unverblümt sagen - bei vielen Veranstaltern noch schrecklich uneffektiv.
Daß wir im Internet-Zeitalter leben, kann man zumindest für erwiesen, darüber hinaus für einen Fortschritt halten. Nebenbei gesagt: ich fürchte nicht um die Post - die wird viele Aufgaben sicherlich behalten.
Man sollte also vielmehr auf längst genutzte Verfahren umdisponieren und sich dazu ein Beispiel an einigen Veranstaltern nehmen, die vorwiegend mit Online-Bewerbungen arbeiten. Exemplarische Links zur Ansicht:
- „cityjazznight.de“, Braunschweig
- „JazzAhead“, Bremen
- Jazz-Festival Idstein
- oder einfach mal „jazz bewerbung“ googeln!
Man müßte nur eine „Veranstalter-Home-Page“ zustande bringen, die u. a. ein Bewerbungsformular enthält - das ist keine Kunst und auch nicht besonders teuer.
Hierzu gibt es hin und wieder Einwände; es wird vielfach auf der einen Seite erwartet, daß die Erstellung von Internet-Seiten praktisch umsonst gemacht wird, andererseits hört man zuweilen auch schon mal von recht deftigen Honorarforderungen.
Das Eine ist - wer hätte es erraten? - ebenso unangemessen wie das Andere. Ersteres, weil schon relativ bescheidene Ansprüche den Zeitaufwand zur Realisierung der Webseite sehr schnell anwachsen lassen. Ein Laie kann sich davon eigentlich keine Vorstellung machen. Im Übrigen sind hohe Honorarforderungen wohl nicht ganz so problematisch - es wird sich ebenso wie im Live-Musik-Bereich schon Jemand finden, der preislich drunterbleibt ...
Wieder im Ernst: es ist sehr schwer zu sagen, in welchem Preisbereich eine gute Website liegen könnte bzw. sollte.
Die Überarbeitung einer bereits vorhandenen Seite kann günstiger liegen - das ist aber nicht die Regel; je nachdem ist es halt empfehlenswerter, gleich eine neue Seite zu erstellen. Um eine sehr ungefähre Aussage zu wagen: ich würde mir die Kosten je nach Aufwand in der Ausstattung irgendwo zwischen €600.- und €1.200.- vorstellen. So etwas wäre im Profi-Bereich ein relativ günstiges Angebot - vorsichtshalber möchte ich aber noch einmal die Unverbindlichkeit der Aussage betonen (Anm.: wir schreiben das Jahr 2009).
Viele Veranstalter haben längst eine Home Page. Selten allerdings findet man einen vernünftig gestalteten Menüpunkt für Musiker, die sich bewerben wollen. Innerhalb eines solchen Menüs sollten außer der bitteschön aktuellen Kontaktadresse auch Richtlinien zu Bewerbungsvoraussetzungen stehen. So könnten Musiker von vornherein erfahren, ob eine Online-Bewerbung oder eine Zusendung von Info-Material per Post bevorzugt wird und sich gleich noch über Bürozeiten und Programmplanungs-Zeiträume informieren. Man könnte vielleicht sogar ein Formular zum Download bereitstellen, mit dessen Rücksendung der Veranstalter eine übersichtliche, standardisierte Bewerbung bekäme usw.
Die maximale Gagenhöhe muß ja nicht gleich dazugeschrieben werden ...
Um noch einmal auf das Thema „Print oder Web“ zurückkommen - gedrucktes Info-Material mit CD (meist als Original) ist ein immer noch aktueller Standard.
Einen großen Teil der Post mit all diesen Druckerzeugnissen könnte man sich doch aber heutzutage endlich einmal sparen, oder? Der Umwelt und meinem Etat würde das jedenfalls gut gefallen.
Und die Post würde am Wegfall des Aufkommens von Bewerbungsunterlagen ausgerechnet der Jazz-Szene auch nicht gerade gleich eingehen. Wozu braucht man diese Körbe voller Einsendungen?
Natürlich muß man (mit mir, jedenfalls) nicht darüber diskutieren, daß ein engagiert ausgeführtes Info-Material durchaus einen entsprechenden Eindruck von der Kreativität und Seriosität des musikalischen Inhaltes vermittelt. Es imponiert doch schließlich, wenn das Info-Design auf 280g/qm-Papier zum Beispiel so irgendwo zwischen „Jaeger-LeCoultre“-Uhren und Flyerwerbung zum nächsten Poetry-Slam-Marathon liegt (gebt´s doch zu). Im Ernst: wozu führt die Konkurrenz im Design des Info-Materials - daß am Ende der exklusivste Prospekt „gewinnt“?
Eine weitere Anmerkung möchte ich dem erwähnten Experiment mit meinem selbstentwickelten interaktiven Kontakt-Formular, auf das ich Veranstalter im Verlauf von Bewerbungen hinzuweisen versuche, noch hinzufügen.
Ich hatte früher schon einmal die Idee, die Art „Rückantwort-Karte mit Möglichkeiten zum Ankreuzen“ zu verschicken. Das habe ich sogar einmal gemacht: nämlich einen Stapel Postkarten mit einem im Copy-Shop vervielfältigten Papier beklebt, auf dem ich mit Schreibmaschine und handgemalten Kästchen (heute: „Check-Boxen“) einen Text verfaßt hatte. Dort konnte man z. B. ankreuzen, daß man an meiner Musik interessiert oder auch nicht interessiert sei und so weiter (also das echte „Multipel-Scheiss“-Verfahren). Die selbstverständlich frankierten und mit meiner Adresse beschrifteten Karten habe ich in Brief-Couverts incl. Anschreiben an Jazz-Clubs geschickt und natürlich auf möglichst positive Antworten gehofft. Offenbar hat man es aber vorgezogen, die Briefmarken abzureißen und anderweitig zu verwenden, denn es kam, glaube ich, nur eine einzige dieser Karten zurück...
Wie gesagt, bin ich gespannt, ob die „virtuelle Neuauflage“ auf meiner Home Page jetzt andere Resultate erbringt.
Man könnte also den ganzen Print-Bereich getrost reduzieren (jedenfalls, wenn wir zunächst noch beim Ausgangs-Thema „Akquise im Bereich der Jazz-Szene“ bleiben); die gesamte Präsentation sollte endgültig auf den Internet-Bereich verlagert werden - und zwar möglichst mit der pluralistischen Gesinnung, auch äußerlich schlichte, dabei inhaltlich vernünftig ausgestattete „Standard Pages“ wie zum Beispiel sogenannte Myspace-Seiten wahrzunehmen.
Bekanntlich kann man die ja auch mehr oder weniger aufwendig verschönern. Hier ist als Anschauungsmaterial ein Link zu einer meiner „myspace“-Seiten. Das Ziel war, mit einer relativ schlichten Gestaltung eine angenehme und individuell wirkende Website zustande zu bringen, die insgesamt ein wenig besser ist als die Standard-Ausführung. Die Seite war zwar in der Erstellung aufwendiger, als es aussieht - aber man kann ja die paar kleineren Dekorationen wie z. B. das Pic im „Kontaktaufnahme“-Fenster auch weglassen.
So wäre es dann nicht besonders schwierig, eine solche Seite zu machen (es gibt dafür ja auch spezielle „Assistenz-Seiten“ wie z. B. www.pimp-my-profile.com).
Andererseits: wenn irgend ein Mensch keine Möglichkeiten sieht, seine „myspace“-Seite optisch etwas aufzumöbeln - warum sollten solche Seiten nicht mitunter auch mal ohne spezielleres Styling auskommen? Wenn der Inhalt bemerkenswert ist, genügt die einfache Grundausstattung an Gestaltung - schließlich sollte doch die Musik das entscheidende Wort haben. Ich bin jedenfalls der Meinung, daß „myspace“-Seiten in Standardausführung so unansehnlich nicht sind.
Um dem eventuellen Verdacht vorzubeugen, irgendeiner Ideologie von alt-linkem Wertkonservativismus anzuhängen, möchte ich betonen, den Wert einer guten Gestaltung von Internet-Seiten nicht etwa in Abrede zu stellen, sondern vielmehr, daß auch Musiker, die nicht so viel Talent zum Webdesign haben (wie ich :-)), eine Chance haben müssen, ihre Musik so zu präsentieren, daß sie damit ernst genommen werden können.
Insofern wäre dies, wie gesagt, eher eine Art „pluralistischer“ Grundgedanke (daß der ebenfalls bzw. wiederum in ideologischer Richtung interpretiert werden könnte, ist mir klar, aber auch wurscht egal und im Übrigen als indirekt relevantes „Seitenthema“ den weitergehenden Betrachtungen eines späteren Kapitels vorbehalten).
Die Forderung nach einer jedenfalls schlichten, informativen Internet-Seite kann man mittlerweile nun wirklich an jeden Musiker stellen. Gut, es würde in der Konsequenz darauf hinauslaufen, daß ein Musiker, der nicht mal eine „Myspace“-Seite im vorgegebene Standard-Design zuwege bringt, sich eben auch nicht bewerben kann, basta.
Meine Meinung dazu: einverstanden.
Also: auf dem Online-Bewerbungs-Formular der „Veranstalter-Page“ müßte ein Musiker theoretisch und als absolutes Minimum nicht viel mehr als seine Kontakt-Adresse und die Adresse seiner Home Page (o. ä.) eingeben.
Zudem müssen Hörbeispiele auf der Website zu finden sein (was in Anbetracht der GEMA-Problematik als eine Art offenes Geheimnis auf den meisten Musiker-Home-Pages gleichwohl der Fall ist - insbesondere auf den erwähnten „myspace“-Seiten ...).
Eine andere Möglichkeit besteht darin, daß der Musiker einen kostenlosen „Account“ bei einem Online-Speicher wie z. B. „mydrive“ eröffnet, darauf seine Demo-Soundfiles hochlädt und dem Veranstalter den Benutzernamen sowie das Kennwort eines sog. Gast-Zuganges schickt (der übrigens für die Gäste eine Zugangsbeschränkung auf die Download-Funktion beinhaltet).
Falls es „veranstalterseits“ ein Planungsgremium gibt, können diese Home-Page-Adressen (URLs) - am ehesten wohl in Listen-Form - vom Büro per Mail an die Mitglieder des Gremiums weitergeleitet werden. Der Organisationsleiter würde ggf. die beiden Daten des Online-Accounts - also den Benutzernamen und das Kennwort - einfach mit auf die Liste der vom Planungsgremium zu prüfenden Bewerbungen setzen, sodaß alle zuständigen Personen Zugriff auf sämtliche relevanten Daten hätten.
Warum nicht so? Worin sollte dabei ein Problem bestehen?
Das System entspricht übrigens im Wesentlichen dem ebenso einfachen wie bereits relativ weit entwickelten Procedere der IG-Jazz Mannheim - in puncto Sichtung von Bewerbungen für den „Neuen Deutschen Jazz-Preis Mannheim“. Einen kleinen Unterschied verursacht in diesem Fall lediglich die Aufgabenstellung des Wettbewerbs um den „Preis“, da hierbei die Wahrung der Anonymität der Einsendungen gewährleistet sein muß.
Das läuft so ab: es werden zur Bewerbung außer einem ausgefüllten Bewerbungsformular unbeschriftete CDs angefordert. Das ist übrigens auf der Home Page der IG-Jazz Mannheim komplett klar und deutlich dargestellt - inklusive einem herunterladbaren Bewerbungsformular.
Nachdem der Vorstand die eingesandten Formulare sowie die CDs durchnumeriert hat, lädt er die CDs auf den kennwortgesicherten Online-Speicher hoch - natürlich wiederum mit entsprechender Numerierung und ohne jede weitere Benennung, denn es muß ja schließlich ein „blindfold test“ sein.
Daraufhin bekommt die Programmkommission die Zugangs-Kennworte und es kann allerseits darauf zugegriffen werden. Jeder kann sich die Hörbeispiele auch auf CD brennen und während irgendwelcher Autofahrten anhören; das spart nochmal Zeit. Anschließend senden die Kommissionsmitglieder die Ergebnisse ihrer Einschätzungen per Mail (wiederum in Tabellenform, versehen mit Bewertungs-Symbolen von „+“ über „0“ bis „-“ an den Vorstandsvorsitzenden bzw. Organisationsleiter. Nachdem alle Mails dort also zusammengelaufen sind, werden sie entsprechend ausgewertet; die wertvolle Zeit von Sitzungsterminen muß dafür nicht mehr verschwendet werden.
Das ist eine Organisations-Methode, die man wohl auch für einen regulären Konzertbetrieb passend zurechtschneidern könnte.
Es geht halt jedenfalls nicht an, Sitzungstermine von Programmbeiratskommissionen z. B. im Biergarten abzuhalten, in denen man sich gegenseitig Stapel von Bewerbungsmappen überreicht - „hier, da mußt Du auch mal reinhören“. Das bringt zwar Licht und Luft in die erwähnten Sediment- und Gesteinsschichten (sie heißen wirklich „Warven“) aber das Arbeitstempo erinnert dementsprechend fatal an das von Regenwürmern. Allerdings dürfte deren Personaldichte höher liegen. Bis so eine Mappe mal herumgewandert ist, können also Wochen und Monate ins Land gegangen sein. Wenn diese Arbeitsweise ein Grund dafür sein sollte, daß wir immer noch Hochglanzprospekte mit unseren Original-CDs versenden müssen (die später längst nicht nur in Privatsammlungen landen), dann: bloß weg mit diesen Methoden. Es genügt ja wohl, wenn man sich im Biergarten über die Musik austauscht, die man entlang der entsprechenden Bewerber-Liste bereits zuvor im Internet angehört hat. Weil man daraufhin nur noch seine diesbezüglichen Notizen mitnehmen muß, könnte man vielleicht sogar mit dem Rad hinfahren - was wohl weniger gut ginge, wenn man Kartons voller Bewerbungsmaterialien mitzuschleppen hätte.
Zum Glück gibt es immer mehr Veranstalter in der Szene, die moderne Methoden und Medien nutzen und damit umgehen können. Jedoch sind sie - nach meiner subjektiven Beobachtung und Wahrnehmung - derzeit noch nicht in der Mehrheit.
* * *
Die sogenannte Jazz-Szene hat sich seit etwa Anfang der kürzlich vergangenen Dekade - wir schreiben mittlerweile das Jahr 2010 - insbesondere in der Hinsicht verändert, daß berufliche Lebensperspektiven als Jazzmusiker inzwischen relativ limitiert, mithin für einen geringeren Prozentsatz der Aspiranten überhaupt noch zu verwirklichen sind - angesichts deren wachsender Zahl ist das auch kein Wunder. Freilich werden viele Musiker irgendwelche anderen Musiker kennen, die recht vielbeschäftigt sind, aber ich glaube, immer mehr angehende Musiker machen sich Illusionen in der Art und Richtung, daß sie selbst das auch hinbekommen könnten.
Ein bedeutendes Problem besteht darin, daß man ein einmal erreichtes Niveau in seinem Bekanntheits- oder jedenfalls Beschäftigungsgrad erhalten möchte bzw. muß. Auf dieses Problem stößt selbstverständlich Jeder, der sich als Profi-Musiker betätigt - natürlich auch bekannte Persönlichkeiten, von denen man möglicherweise glauben könnte, daß ihre Popularität sie davor irgendwie schützen könnte. Ich habe neulich in einem Gespräch mit einem Redakteur des „Jazz Podium“ davon erfahren, daß auch ein Joshua Redman freimütig darüber berichtet, sich unter Einsatz eines erheblichen Teils seiner Arbeitszeit mit organisatorischen und geschäftlichen Dingen zu beschäftigen - und besonders mit der (Management-)Arbeit daran, die Kontinuität seiner Bühnen- und Medien-Präsenz aufrecht zu erhalten.
Klar, je geringer diese Bühnen- und Medien-Präsenz gerade ist, desto vielfältigere Arbeitsmöglichkeiten muß man sich beschaffen. Unterrichten und die Mitwirkung in diversen Gruppen ist für die Allermeisten eine Art organischer Bestandteil eines Musikerlebens. Wenn es nicht so gut läuft, muß irgendwie anderweitig aufgestockt werden. Ob Tanzmusik oder Taxifahren den Vorzug erhält, ist Gelegenheiten oder der subjektiven Befindlichkeit vorbehalten. Auch in meiner Brieftasche befindet sich eine mittlerweile allerdings erloschene Personenbeförderungs-Lizenz (sprich: Taxischein) aus den 90er Jahren für „Mannheim-Stadt“. Selbstverständlich liegt in dergleichen Lebenslagen eine Gefahr, sich zu verzetteln. Besonders treffend beschrieben ist das Problem, wie ich meine, mit einem Zitat Arthur Schopenhauers (1788 - 1860):
„Daher kommt es, daß wir oft auf Dinge hinarbeiten, welche, wenn endlich erlangt, uns nicht mehr angemessen sind; wie auch, daß wir mit den Vorarbeiten zu einem Werke die Jahre hinbringen, welche derweilen unvermerkt uns die Kräfte zur Ausführung desselben rauben.“
Dem kann ich hier nichts hinzufügen.
Die Arbeitsmöglichkeiten als Jazzmusiker waren sowieso schon immer ziemlich gemischt. Man hat ja meist nicht nur Jazz gespielt (und gehört) - schließlich ist meine Generation weit eher mit Rock, Soul, Fusion etc. aufgewachsen.
Ich kann berichten, daß, wer sich als junger Mensch in den 1970er Jahren für Jazz begeistert hat, sich, sagen wir mal, recht zeitnah mit einigen Umstrukturierungen seines sozialen Umfeldes konfrontiert sehen konnte. Nicht gerade dasselbe, aber Ähnliches läßt sich allerdings auch für alle weiteren seither erlebten Dekaden sagen.
* * *
Exkurs zu jüngerer Musikgeschichte anhand von Betrachtungen über gesellschaftliche Entwicklungen (in besonderem Hinblick auf wirtschaftliche Aspekte)
An der Stelle scheint mir ein kleiner Exkurs angebracht; hier soll es eher um Musik und Gesellschaft im Allgemeinen und um „Wirtschaftliches“ gehen - mit einem etwas detaillierteren Blick auf „Pop“ (ach ja: Populus - lateinisch für: die Gesellschaft, das Volk).
Der größere Teil der Bevölkerung konsumiert natürlich Pop-Musik - allerdings war deren Anteil bis in die späten 1970er Jahre noch nicht so flächendeckend und marktbeherrschend. Die Generationen pflegten einen relativ unterschiedlichen oder jedenfalls unterscheidbaren Musikgeschmack, worauf sozusagen beiderseits ein gewisser Wert gelegt wurde - was übrigens im Hinblick auf viele Familiensituationen der damaligen Zeit eine recht milde Formulierung sein könnte.
Sicherlich wäre es ein interessantes Objekt weitergehender Betrachtungen, ob spätere Annäherungen im Musikgeschmack der Generationen - Eltern und Kinder umgaben sich irgendwann später ja weitgehend mit gleichen oder doch sehr ähnlichen Arten von Pop-Musik - zum Beispiel eher aus einer eventuell andersartigen Verständigung oder der später etablierten allgemeinen Idealisierung von Jugendlichkeit entstanden ist - oder ob das Ganze auch einen Charakter von Nivellierung hatte, von welcher Seite dabei entsprechende Initiativen ausgingen (eher von der „Generation der Älteren“? Von „der Medienindustrie“?) - das würde hier jedoch zu weit führen.
Der Begriff „Pop“ kam wohl ungefähr in der zweiten Hälfte der 60er auf und war jedenfalls (zumindest in Deutschland) noch bis in die 70er mehr oder weniger deutlich mit dem Image von Schlager-Musik behaftet, die Elemente aus der Subkultur jugendlicher Protestbewegungen als modische Dekoration beimischte.
Kreativität im Bereich Pop bestand in erster Linie aus solcherlei Adaptionen und Mischungen; inwieweit sich darin in Bezug auf kreative „eigene“ Ideen etwas geändert hat, wäre ein weiteres interessantes Objekt von Betrachtungen, die hier zu weit führen würden. Letzteres gälte auch für Betrachtungen über die „Beatles“ als eine Art Sonder-Phänomen und Paradebeispiel von kreativer Musik einer Band, die eine ebenso gelungene wie erfolgreiche Verbindung von Pop und Rock schuf.
Obwohl sich die Schlager- und die Pop-Welt schon in den 60ern beeilt hatte, so schnell wie möglich insbesondere Rock-Elemente zu adaptieren, waren beide zu der Zeit noch recht deutlich von Rockmusik unterscheidbar. Manche Schlager klangen sogar noch ein wenig nach Jazz - wohl aus Versehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Man könnte vielleicht sagen: Pop war ansonsten noch „Irgendetwas zwischen Rock und Schlager“, von beidem mal mehr, mal weniger entfernt.
In weiten Kreisen der jüngeren Leute spielte Pop keine bedeutende Rolle - das Zeug stand in dem Ruf, „kommerziell“ zu sein und das war zu jener Zeit eben ein Makel (ganz besonders in der relativ umfangreichen „alternativen“ Szene). Ich glaube, daß man Auswirkungen der Kulturrevolution, die die jüngere Generation in den 1960er Jahren initiiert hatte, in den polarisierenden Zügen des Zeitgeistes der 70er noch recht deutlich wahrnehmen konnte.
Es ist heutzutage selbstverständlich nicht ganz einfach, nach Möglichkeit eindeutige Unterschiede zwischen Musik-Stilen zu formulieren - wie zum Beispiel hier zwischen „Pop“ und „Rock“ der 1970er und folgender Jahre - zumal in halbwegs differenziertem Bezug zu Perioden von gewissen stilistischen Wandlungen. Wie vielleicht schon bemerkbar war, ist mir daran auch nicht allzusehr gelegen. Es ist allemal entscheidender, die Musik zu hören - dann werden Eigenheiten irgendwelcher Stile mit der Zeit schon „ganz von allein“ deutlich.
Wenn ich dennoch versuche, dazu etwas zu schreiben, richte ich das eigentlich an Leser, die Vieles an unterschiedlicher Musik bereits kennen. Ich möchte hier, wie schon im Vorwort bemerkt, keine wissenschaftliche Analysen und Definitionen unternehmen, sondern bei der Schilderung meiner Erfahrungen, Wahrnehmungen und Reflexionen bleiben und gegebenenfalls einige Ansichten und Meinungen sozusagen der gedanklichen Anregung des geneigten Lesers zur Verfügung stellen. Man könnte sich freilich an vielen einzelnen Thesen, Themen und Seitenaspekten ein- und festhaken - davon möchte ich jedoch abraten und empfehlen, bei eventuell auftauchenden Fragen oder gar Widerspruchsregungen ein wenig abzuwarten, ob sich nicht etwas später, gegebenenfalls spätestens aus der Gesamtlektüre hinreichend erschließen läßt, was ich meine. Daher, sowieso und überhaupt schon einmal im Voraus vielen Dank für die geschätzte Aufmerksamkeit!
Im Übrigen soll an dieser Stelle auf diesbezügliche Fachliteratur verwiesen sein, die spezifische Analysen und Definitionen längst besser bewältigt hat. Von ein paar „Wikipedia“-Seiten einmal abgesehen, habe ich beim Verfassen dieses Textes keine Literatur zu Rate gezogen - mit einer Ausnahme, auf die ich gleich zu sprechen komme. Gewisse Ungenauigkeiten mögen mir daher gegebenenfalls verziehen werden.
* * *
Eine gewisse Zeitlang während der Nachkriegszeit waren, wenn man so will, Schlager und Jazz so ziemlich die einzige Pop-Musik. Mir selbst und vermutlich vielen Anderen fällt es heutzutage gar nicht so leicht, sich das vorzustellen. Mit den späteren 1950er Jahren hatte sich das Geschehen bereits in einige andere Richtungen entwickelt.
Ich bin 1957 geboren und habe mich immer sehr dafür interessiert wie es - natürlich besonders im Bezug auf Jazz - vor meinem bewußten Erleben halt so zuging. Ich finde es faszinierend, mehr über solche Zeiten und das Leben in diesen Zeiten zu erfahren. Genau aus diesem Grund waren für mich einige auf einem Dachboden gefundene Ausgaben der Zeitschrift „Bravo“ aus der Zeit der ersten 60er Jahre eine hochinteressante Lektüre, aus der sehr viel damaliger Zeitgeist mit überraschender Anschaulichkeit spricht. (Übrigens kommt in diesen Ausgaben das Wort „Pop“ noch nicht vor.) Insbesondere finden sich darin viele interessante Berichte über die seinerzeitige Musik-Szene - jedenfalls gemäß der Auswahl der „Bravo“-Redakteure nach Relevanz für die Jugend. So steht dort einiges über Schauspieler und Schlager-Stars, ein bißchen auch über Rock´n´Roll-Größen und tatsächlich auch noch - für mich faszinierenderweise - Neuigkeiten über Jazz-Heroen wie Louis Armstrong und Duke Ellington mitsamt Konzerthinweisen. Sogar die bundesdeutsche Szene war einiger Berichte wert, wie zum Beispiel die (in einer Ausgabe von 1962), daß „Hochtrompeter“ Horst Fischer vom Werner Müller Orchester eine Einladung von Tony Curtis für eine Studio-Produktion bekommen hatte. Ein besonders lesenswerter Artikel besteht in einem Interview mit mehreren Tanzorchester-Chefs - auch der eben erwähnte Werner Müller kommt darin zu Wort - über die Zukunft der Tanzmusik und die Einstellungen der Jugend dazu („Macht keiner mehr Musik?" Artikel in der „BRAVO" von März 1963). Auch waren solche Sachen drin wie die Ankündigung der Langspielplatte mit dem schlichten Titel „Bossa Nova“ von Peter Kraus mitsamt vorab gedrucktem deutschen Text von „Desafinado“, bei der es sich keineswegs etwa um eine Übersetzung des Originaltextes handelt, sondern um die - ich kann mich zu keinem anderen Ausdruck entschließen - ziemlich beschissene Version von Ralph Maria Siegel. Es ist vielleicht überflüssig zu erwähnen, daß die mit dem originellen Originaltext so gut wie nichts gemein hat.
Um noch ein wenig bei diesem Thema zu bleiben: von Elvis Presley ist das Liedchen "Bossa Nova Baby" überliefert (aus dem Kinofilm „Fun In Acapulco“ von 1963). Tatsächlich wird er darin von vier leibhaftigen Percussionisten mit allerhand Rassel-Sounds begleitet. Damit sind die Anklänge an Bossa Nova musikalisch aber bereits erschöpft, denn die Nummer ähnelt rhythmisch am ehesten einer Polka (das Gerassel der recht mexikanisch aussehenden Akteure bleibt auch konsequent auf unisono gespielte Achtel beschränkt), dazu hat sie einen sehr schlichten Text und ist im Übrigen harmonisch ähnlich wie ein Blues aufgebaut, wobei allerdings nach der Subdominante zwar noch die Tonika, aber keine Dominante mehr auftaucht.
Die Version wurde 1964 von Bill Ramsey mit einer deutschen Version unterboten, die unter anderem einen eigenen, noch schlichteren Text abbekommen hatte.
Beide Machwerke sind übrigens - zumindest zur Zeit noch - auf "youtube" zu besichtigen. Sie unterscheiden sich ganz besonders in den tänzerischen Darbietungen. Amüsant sind dabei Elvis´ äußerst schlampig geschauspielerte Spezial-Einlagen auf einer dieser zeittypischen, lausig klingenden Elektronik-Orgeln - er tapst zu regelmäßig wiederkehrenden "Fill-Ins" auf der Tastatur herum. Beinahe skurril mutet Bill´s drolliges Tanz-Gehopse an - ganz besonders sein ziemlich linkisches Hinternwackeln, mit dem er wohl ein wenig an Elvis´ Tanzstil anknüpfen wollte...
Für Bossa-Nova-Kenner könnten die beiden Versionen wohl als eindrucksvolles Beispiel dafür gelten, wie weit man das musikalische Sujet (kommerziell) verwässern und damit letztlich komplett verfehlen kann.
Natürlich wollten all diese Epigonen was vom Kuchen der seinerzeitigen Bossa-Nova-Modewelle abhaben - aber nach dem bekannten Vergleich ist Kuchenbacken nun mal etwas anderes als ... ich schenke mir (bzw. uns) ausnahmsweise die Vollendung dieses Satzes.
Die weltweite Popularität des „Bossa Nova“ (s. auch einen Wikipedia-Artikel zu diesem Thema) begann mit Marcel Camus´ berühmten Film „Orfeu Negro“ (1958/59). 1962 komponierte Antônio Carlos Jobim den Song „Garota de Ipanema (Girl from Ipanema)“ mit dem Text von Vinicius de Moraes; 1963 kam die Platte mit der Fassung von Stan Getz und Astrud Gilberto heraus.
1964 begann die Schreckenszeit der Militärdiktatur, die einen vollständigen Wandel des politischen und gesellschaftlichen Klimas in Brasilien erzwang. Auch die Musik wandelte sich, da Kritik unter der Zensur nur noch in doppeldeutigen Texten ausgedrückt werden konnte. Viele Musiker verließen das Land - die meisten in Richtung USA.
Aus den Kreisen des europäischen Showgeschäftes war die hochtalentierte Caterina Valente übrigens die Einzige, die tatsächlich Bossa Nova singen und obendrein ganz ausgezeichnet auf der Gitarre spielen konnte; sie reussierte musikalisch aber vorwiegend mit Schlagern. Infolgedessen war auch sie in der "Bravo" mit einem der üblichen, ausgesprochen dämlichen Klatsch-Artikel vertreten - sogar obendrein als Sammel-Poster in der Form von aus diversen aufeinanderfolgenden "Bravo"-Ausgaben auszuschneidenden Körperteilen, die infolge unbedingt lückenlosen Hinzukaufens der betreffenden Ausgaben sukzessive erbeutet und zu ihrer fast lebensgroßen Ganzheit zusammengeklebt werden konnten, so daß ich wahrhaftig über ein DIN-A-4-großes Abbild eines ihrer derzeitigen Unterarme verfüge - immerhin.
Trotz der Gefahr, sozusagen nolens vollends zu sehr abzuschweifen, kann ich es nicht unterlassen, auf noch einen anderen ebenso hochinteressanten "Bravo"-Beitrag zu sprechen zu kommen: in einer Ausgabe von 1963 geht es in der Serie mit dem vielsagenden Titel "Wir und Ihr" um den schwerwiegenden Gewissenskonflikt (der reiferen Jugend), mit dem über Jahre ersparten Geld zwischen der Investition zu einer "Hochzeit in Weiß" und der Anschaffung einer Waschmaschine zu entscheiden zu müssen. So viel zum damaligen Lebensstandard - und im Übrigen gleich auch noch zur erwähnten Heranziehung von Fachliteratur.
* * *
Schlager gab es ja nun bereits in der Vor- und Kriegszeit - alte Schlager hießen "Kinder, das Leben ist schön", "Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein" oder "Übers Jahr, wenn die Kornblumen blühn"; allein aus dem Film "Das alte Försterhaus" von 1956 stammten Nummern wie "Ach man braucht ja so wenig um glücklich zu sein", "Kinder vertragt euch doch wieder" - sie waren offensichtlich hilfreich, die harte Realität des Lebens in diesen Zeiten auszublenden, zuzudecken oder wenigstens etwas zu mildern.
Nachkriegs-Schlager entsprachen eher dem inmitten der Zerstörung nach dem Krieg wiedererwachenden Lebenshunger und einem sich ausbreitenden Fernweh. Freddy Quinn (bürgerlich Franz Eugen Helmuth Manfred Nidl-Petz) avancierte hier zum (übrigens aufgrund seiner Biographie sogar recht authentischen) Fachmann mit "Die Gitarre und das Meer" oder "Einmal noch nach Bombay", "In Hamburg sind die Nächte lang", "Nimm uns mit Kapitän, in die Ferne", "Es leuchtet das Kreuz des Südens". Ein regelrechte "Fernweh-Schlager"-Flut kam auf mit Nummern wie "Ganz Paris träumt von der Liebe", "Valencia", "Das machen nur die Beine von Dolores", "Spiel mir, lieber Schotte", "Auf Cuba sind die Mädchen braun" usw. usf. Oder die Schlager reflektierten die kleine, heile Welt und die kleinen Alltagsfreuden, die man als junger Mensch genießen konnte - Kinderstar Conny Froboess (geb. 1943) sang: "Pack die Badehose ein" (Komponist: Gerhard Froboess, 1951). Der Italienurlaub, lange vorbereitet mit entsetzlich vielen Liedern von Vico Torriani ("Addio Donna Grazia", "Arrividerci Roma", "Mandolinen und Mondschein", "Tiritomba", "Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein", "Volare") wurde zum Traum der "Trizonesen".
Englischsprachige Titel hatten in den frühen 50ern keine Chance (außer Jazz-Songs, natürlich); Schlagerkonsumenten hatten ohnehin selten auch ein Ohr für Jazz, zumal Englischkenntnisse im damaligen Deutschland noch recht spärlich vorhanden waren. Hier zeigte sich deutlich, wie tíef die gerade beendete Hitlerei den Deutschen noch in den Knochen steckte. Der Rhythmus insbesondere amerikanischer Country-Songs gefiel dann aber doch und prompt wurde ein alter Trick ausgegraben: die Songs wurden unverzüglich mit deutschen Texten ausgerüstet. Oft völlig verfremdet - aus "Oh, Lonesome Me" wurde "Blaues Boot im Sonnenschein und dann zu zwein", aus "Raunchy" wurde "Irgendwo wohnt der alte Joe" und anderes Gesülze von diesem Kaliber.
In Filmen und Liedern einen „typisch amerikanischen Stil“ zu verkaufen (man hatte damit zum Teil erzieherische Absichten!), hatte zunächst allerdings wenig Erfolg („Sündige nicht im Verkehr“, „Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere“ von Peter Alexander, Conny Froboess mit „Du hast dein Schicksal in der Hand“ - eigentlich: „He‘s Got The Whole World In His Hands“).
Schlager waren seit der Nachkriegszeit durch eine damals teilweise neuartige Musikindustrie in flächendeckenden Kampagnen auf so dürftigem musikalisch-geschmacklichen Niveau, insbesondere hinsichtlich der Texte in derart infantil-alberner Simplizität etabliert worden, daß die Grenze zur Debilität oft erreicht und mitunter auch bedenkenlos überschritten wurde.
Sogar heutigen professionellen „Unterbietern“ und „kulturellen Tabu-Brechern“ wie Siegel, Bohlen und ähnlichen Konsorten ist es im Grunde bis in unsere Tage kaum gelungen, ihre Produkte auf dieser „nach unten offenen Dichter-Skala“ noch allzu weit darunter anzusiedeln.
Ein Schlager-Pop-Top-Hit wie „Mohikana Shalali“ (aus den frühen 70ern) legt bereits im Titel offen, wie zielscheibenmittig punktgenau der Bereich von Schwachsinnigkeit und finaler Geschmacklosigkeit getroffen werden kann - hier geht es sozusagen für die Menschheit nicht weiter und man muß wirklich alle Hoffnung fahren lassen. Wir können daher nichts anderes als ein musikalisches Kapitalverbrechen darin erkennen. Von seinem Delinquenten, hier so genannten Interpreten - es handelt sich um den gebürtigen Düsseldorfer Heinz Georg Kramm, besser bekannt als Heino - haben sich in den 1960er Jahren, der Blütezeit des „Beat“, in Deutschland mehr Platten verkauft als zum Beispiel von den Beatles.
So war Pop auch in den 1970ern großenteils durchaus noch mit größtenteils albernen, schnulzigen, oft auch noch regelrecht strunz-bescheuerten Kitsch-Liedchen identifiziert - daher und insofern also viel deutlicher von anderen derzeitigen stilistischen Bereichen unterscheidbar als späterhin und - wie man sich nun wohl denken kann - für hippe junge Leute wie mich eben ganz und gar und überhaupt nicht angesagt.
Ob es irgendwie verwunderlich sein könnte, daß heutige Schlager noch genauso hundsmiserabel sind, soll hier einmal dahingestellt sein - sie sind es offenbar, nur ein wenig anders. An kindischer Albernheit und ausgewachsener Schwachsinnigkeit hat sich die Niveau-Definition sicherlich nicht von der Stelle bewegt, allerdings hat die Infantilität vielfach unverblümtere pubertäre Züge bekommen, das Pathos hat stark aufgeholt und die Schmalzigkeit ist oft sogar noch perfider.
Das Schlimmste an der ganzen Schlagerei war und ist jedoch die Etablierung und Popularisierung dieser unerträglichen, künstlich aufgesetzten sogenannten volkstümlichen Musik.
Ursprünglich wurde die sentimentale Gefühlslage heimgekehrter Soldaten mit sogenannten Heimatfilmen bedient - anfangs erfreuten sich insbesondere Laientheaterstücke mit "Heimat"-Themen großer Beliebtheit. Aus solchern Strömungen entstand auch eine Art neuer "Heimat"-Lieder ("Eine weiße Hochzeitskutsche", "Die Fischerin vom Bodensee", "Oh Heideröslein", "Rauschende Birken", "Wo der Wildbach rauscht"). Das Genre hat sich in der Tat entwickelt...
Seit Längerem schon gehören die „Spastelruther Katzen“ sowie das „Napalm Duo“ zu meinen persönlichen Lieblingsbeispielen dafür; das Produkt „Hansi Hinternseher“ halte ich für ein solch entsetzliches Paradebeispiel, daß ich aus purer Rache für die Schmerzen, die mir so etwas verursacht, auch diesen Kalauer gerade noch durchgehen lassen möchte (im Übrigen vermute ich, daß auf den Einfall sowieso bereits Einige vor mir gekommen sind).
Auch derartige Œuvre waren ja ein Produkt-Segment, das in dieser Form erst in der Nachkriegszeit der frühen 50er entstanden ist. Zwar nichts gänzlich Neues - natürlich aus dem Kaffeesatz von infolge des Mißbrauchs durch das Nazi-Regime belasteter „richtiger“ Volksmusik aufgebrüht - aber in der Art und Weise, wie das Zeug zubereitet wurde, kann man wohl von allem Anfang an einen ausgesprochen skrupellosen Opportunismus erkennen. Die Produktions-Intentionen dieser unsäglichen Absonderungen haben, so meine ich, amoralischen, mithin geradezu verbrecherischen Charakter; zur Vermarktung gehört eindeutig kriminelle Energie (zum Glück bedeutet diese musikalische Umweltverschmutzung wenigstens keinen entsprechend proportionalen CO²-Ausstoß). Ich gebe ungefragt zu: es würde mir persönlich recht schwerfallen, Konsumenten dieser unsäglichen Ware nicht in aller Regel polemisch als zum Beispiel „geistige Null-Ouverts“ zu bezeichnen. Immerhin stellt man mir keine derartigen Fragen.
Im Zusammenhang mit Verblödungs-Kampagnen der Medien (in diesem Fall der hiesigen sogenannten TV-Landschaft) hat der deutsche Schriftsteller Franz Xaver Kroetz einmal bedauernd gesagt, es gebe zwar Gesetze gegen Volksverhetzung, aber leider keine gegen Volksverdummung.
Er bekam übrigens 1971 seine erste größere Publicity dadurch, daß Uraufführungen zweier seiner Theaterstücke in München von Neo-Nazis attackiert wurden.
Genug davon.
* * *
Spätestens seit Beginn der 1980er Jahre entwickelte man effektivere Modernisierungs-Strategien im Pop-Business - die Rezeptur von Adaptionen, Konglomeraten usw. entsprach nicht nur im Pop-Bereich dem sogenannten Zeitgeist. Obwohl es mir persönlich schwerfallen würde, aus Erinnerung und aktuellem Wissensstand heraus sozusagen freihändig zu definieren, inwieweit diese Tendenzen einer Wechselwirkung aus allgemeinem Zeitgeist sowie Produkten der Musik-Industrie entstammten oder vielleicht eher von Letzterer ins Leben gerufen worden sind, scheint mir der schlichte Hinweis angebracht, daß es ja zumindest in der Pop-Branche nie ein Geheimnis war, daß man mit vielfältigeren Stil-Mischungen größere Breitenwirkungen erzielen kann.
So wie spätestens mit dem Beginn der 1960er Rock und Soul „angesagt“ waren, entwickelte sich in den 1970er Jahren eine wachsende Popularität von Mischformen aus Beidem - jeweils auch wiederum mit Jazz-Elementen. Die meisten jüngeren Jazzmusiker (ich auch) bezogen ihre frühen Inspirationen weniger aus traditionelleren Jazz-Stilen als aus diesen neuen Fusionen, die bald allgemein als Jazz bezeichnet wurden - alles andere wurde nach traditioneller Art der Jugend recht undifferenziert und pauschal als altmodisch betrachtet, mitunter gleich als „Oldtime Jazz“ oder „Dixieland“ abgetan.
Dixieland hatte sich übrigens spätestens zu der Zeit das wenig schmeichelhafte Zusatz-Attribut „Bier-Jazz“ erworben. Freilich nicht eben zu Unrecht, wenn auch nicht in erster Linie aus musikalischen Gründen. Soviel ich weiß, entstammt der Spruch „ die Musik ist so gut, wie die Leut´ saufen“ der wirtsseitigen Wertschätzung des Dixieland eben jener Zeit.
Zu Recht wiederum - das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben - hat eine Vielzahl von höchst mediokren Amateur-Bands und „Feierabend-Jazzern“ ein Übriges zu diesem „Label“, somit zur musikalischen Diskreditierung des Dixieland beigetragen. Ich meine, es ist damit mal wieder so: wenn man hinhört und sich ein wenig darauf einläßt, wird man vielleicht bald unterscheiden und möglicherweise Gefallen „am Besseren“ finden können. Natürlich wissen allerhand Leute, was Dixieland eigentlich ist, vielleicht sogar, worin er sich von „New Orleans Jazz“ unterscheidet oder daß Leute wie Louis Armstrong und Tommy Dorsey auch Dixieland gespielt haben usw.
Trotz all der schrecklichen "Zickendraht"
-Kapellen gab und gibt es nicht wenige gute Bands - auch in Deutschland!
Um die Mitte der 1970er Jahre kamen die dem Vorbild der Schützenfeste entlehnten „Volks“-Feste auf, die eine bis dato nicht gekannte Häufigkeit in von der Öffentlichkeit getragenen Legitimierungen kollektiver Besäufnisse und den Ruin vieler lokaler Gastronomen mit sich brachten.
Ich erinnere mich an die gespenstische Szenerie einer frühmorgendlichen menschenleeren Straße im Zentrum der Braunschweiger Altstadt, die von einem Meer im Winde raschelnder, in kleinen, hilflos und ziellos wirkenden Bewegungen rollender Plastikbecher dicht übersät war. Einweg-Plastikbecher waren damals irgendwie auch noch etwas Neues und jedenfalls bislang sozusagen noch längst nicht in aller Munde gewesen. Ich erinnere mich an mein Staunen über dieses seltsame Meerespanorama - so etwas hatte ich noch nie gesehen. Und um genau zu sein, erinnere ich mich auch an mein Empfinden einer gewissen Trostlosigkeit und eigenartiger Fremdheit, als ich diese Straße, in der ich nämlich wohnte, entlangging. Der raschelnde Chor hunderter Plastikbecher in der Morgenröte gab dem weiten Platz vor der Kirche etwas besonders Unwirkliches. In der Nacht vorher war dort ein derart frenetischer Lärm gewesen, daß man ja zu der frühen Morgenstunde noch wach war - und nicht etwa „schon wach“. Das finstere Gebrüll der Kerle und das Kreischen der Weiber ging bis zum Morgengrauen; offenbar war zu dieser Pionierzeit der neuen Volksfeste das Sperrstundenreglement noch nicht so ausgereift. Bevor der Spuk vorbei war, hätten wir uns jedenfalls nicht vor die Tür getraut.
Das hatte einige gute Gründe, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Ich kann die Begebenheit mithilfe dieser Wohnadresse und der mir verbliebenen „Gestalt“ einer seinerzeitigen Freundin historisch genau auf Sommer 1977 datieren. Und außerdem habe ich dort dann tatsächlich nicht mehr lange gewohnt. Das hatte natürlich diverse andere Gründe.
Mit der Verbreitung dieser Gelage kamen viele Dixieland-Bands zu Auftrittsmöglichkeiten, die allerdings das „Bier-Image“ des Dixieland-Jazz noch weiter zementierten. In der früheren Zeit dieser zu irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Anlässen stattfindenden Sauf-„Feste“ spielten dort praktisch noch keine Rock-Bands. Rockmusiker hatten lange Haare, manche sogar Ohrringe und genossen die allgemeine Wertschätzung von Bürgerschrecks. Der Zeitgeist und die gesellschaftliche Atmosphäre waren von starker Polarisierung geprägt und Rockmusiker standen in den Augen der etwas älteren oder jedenfalls konservativeren Bevölkerung auf derselben Seite wie Hippies („Gammler“), Linke („Kommunisten“), Zivildienstleistende („Drückeberger“), Öko-Freaks („Körnerfresser“). Studenten (alles gleichzeitig) und nicht zuletzt RAF-Terroristen (oder wenigstens „Sympathisanten“). Die Stimmung war polemisch und eindeutig bedrohlich, sie wurde täglich im TV und besonders durch die eifernde, geradezu schäumende sogenannte Springer-Presse (u. a. „Bild-Zeitung“) scharf angefacht. Die meisten Medien waren flächendeckend angeschlossen; es wurde gelogen, daß sich die Balken bogen. Eine heute kaum noch vorstellbare Hetz-Propaganda wurde tagtäglich über die Leute ergossen.
Ich war etwas zu jung für die sogenannten "Achtundsechziger". Wir wollten am liebsten noch cooler sein als diese unsere "älteren Brüder". Klar, daß das "Establishment" alle in den einen "Achtundsechziger"-Topf warf (auch "Hippie" war als Bezeichnung natürlich gebräuchlich). Wir selbst bezeichneten uns zu der Zeit meist als "Freaks".
Ich zitiere hier zum Begriff "... die Achtundsechziger“ meinen Freund Frank-Ulrich Voegely:
"Der Begriff ist totaler Blödsinn. Alle denken sofort an die RAF und die Bomben, dabei war das eine winzige Minderheit. Die Basis war total pazifistisch. Realität war, dass man in den Geschäften nicht bedient wurde, wenn man lange Haare hatte. An diese Zeit habe ich meine eigenen Erinnerungen; sie ist ein Teil von mir, ein Teil meiner Identität. ... Heute kann man sich das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Ganz Europa war eine einzige Euphorie. Ich war in Florenz, in Paris. Ich bin nach Prag gefahren. Überall waren die Menschen politisiert, wollten gemeinsam etwas ändern. Sie wollten Freiheit. Wenn du so was erlebt hast, das in Prag, dann lässt es dich dein ganzes Leben nicht mehr los. Die Sehnsucht nach Freiheit. Wer den Geschmack der Freiheit einmal auf der Zunge hatte, der vergisst das niemals."
Ich finde, man kann es kaum besser in eine Kurz-Beschreibung fassen.
Mit meinem damaligen „Outfit“ paßte ich ohne viel weiteres eigenes Zutun ganz vorzüglich in sämtliche Klischee-Kategorien und wurde an jeder Straßenecke schief angeglotzt - es genügte für denkwürdige bis abenteuerliche Erlebnisse.

Etwa 1981 (mit Kontrabaß auf dem
Bahnhof in Freiburg/Br.)
Eine Menschenmenge in „Volksfest“-Stimmung zu durchqueren hätte mich zwar ohnehin abgestoßen, aber zugleich hätte ich es mich auch ganz einfach nicht getraut. Selbst die alltäglichsten Situationen standen unter dem Einfluß dieses Zeitgeistes: mich durch einen Straßenbahnwaggon zu bewegen, konnte den Charakter eines Spießrutenlaufs annehmen. Je mehr Personen sich darin befanden, desto drohender wurden die Blicke. Man wurde hin und wieder blöd angequatscht, meist wurde jedoch nur aus sicherer Distanz irgendetwas gerufen. Es ist in der Tat öfters passiert, daß mir Kinder auf einer ganz normalen Wohngebietsstraße das Wort „Sympathisant“ nachriefen. Man hatte ihnen unzweifelhaft beigebracht, wie so einer aussieht. So wurde ich ein „schwarzer Mann“, ganz ohne schwarz zu sein. Aus heutiger Sicht ist das vielleicht schwer vorstellbar. Zumal ich bezweifle, daß so viele Kinder heutzutage überhaupt noch in der Lage wären, ein derart kompliziertes Wort makellos und unfallfrei auszusprechen.
In der Zeit wollte ich gerade erwachsen werden. Da „die Erwachsenen“ bei mir aber, spätestens seit ich zehn war, gründlich verschissen hatten, wollte ich ein ganz anderes, möglichst komplett neues Erwachsensein (mit-)entwickeln. Leicht gesagt, aber damit hatte ich ein heftiges Problem mit auf den Weg bekommen. Und genommen - das fand ich allerdings erst später heraus. Man hatte in dieser Zeit eigentlich nur unter seinesgleichen das Gefühl, sich irgendwie heimisch zu fühlen und bewegen zu können. Was war „Seinesgleichen“?
Natürlich die Leute, die so und so aussahen und so und so drauf waren und - das war wichtig - die und die Musik hörten. Freaks eben. Alles andere war ziemlich vermintes Gelände.
Unter Anderen bestand in dieser „alternativen Szene“ ein selbstverständlicher Konsens darin, daß man gegen Atomkraftwerke war - von atomarer Rüstung ganz zu schweigen. Beides hatte sich auf seine Weise zu Themen der Zeit entwickelt. Letzteres seit geraumer Weile - eigentlich bereits seit den frühen 1960er Jahren - dafür aber gegen Ende der 70er Jahre mal wieder mit besonderer Brisanz, die sich insbesondere mit der Problematik des seinerzeit nicht zuletzt durch diese idiotischen, desinformativ-agitatorischen Medien-Kampagnen politisch schwer einschätzbaren „NATO-Nachrüstungs-Doppelbeschlusses“ einstellte. Die Auseinandersetzung löste gegen Ende der 70er Jahre eine „Friedensbewegung“ aus, die zwar von der ohnehin anti-atom-bewegten „alternative Szene“ ausging, aber einigen Zulauf aus weiteren Kreisen der Bevölkerung bekam. Während die Medien in täglichen Tiraden Haß auf Kommunisten, Terroristen und alles Mögliche predigten, fanden auch noch mehrere tödliche Attentate der RAF auf Personen des öffentlichen Lebens der Bundesrepublik statt - das brachte besondere Schärfe und Hysterie in das allgemeine gesellschaftliche Klima. Die RAF hatte ja wahrhaftig die abstruse Zielvorstellung, das politische System der Bundesrepublik zu destabilisieren - was sich in gewisser Weise eine Zeitlang tatsächlich anzubahnen schien.
Es war schon wirklich häßlich, damals andauernd und pauschal als RAF-Sympathisant bezeichnet zu werden. Buntbemalte Autos wurden ständig von der Polizei angehalten; die Personenkontrolle ging nicht selten so vor sich, daß die Autoinsassen Maschinenpistolen (!) vorgehalten bekamen und mit erhobenen Händen an der nächsten Hauswand stehen mußten, während das Auto „gefilzt“ wurde. Auch als Fußgänger konnte man zum Beispiel am hellichten Tag mitten in der Stadt der Möglichkeit gegenwärtig sein, ziemlich barschen Polizisten den Ausweis vorzeigen zu müssen. Oft kam es dabei vor, daß umstehende Schaulustige Zurufe absonderten, in denen nicht selten etwas von „Abführen“, auch „Arbeitslager“ und dergleichen zu vernehmen waren. Das ist keine Übertreibung, sondern gehörte wirklich eine Zeitlang zum Alltag und ist auch mir mehr als einmal so passiert.

Etwa 1980 am E-Baß (in Karlsruhe).
Ein Freund von mir war zu einer Art Buchführung übergegangen, indem er in seinem alten VW-Bus auf das Blech des Armaturenbrettes das Wort „Polizeikontrollen“ eingeritzt hatte und darunter in gleicher Weise eine Strichliste in Form der bekannten „Fünferpakete“ führte. Es kamen in der Tat allerhand davon zusammen. Ein bunter VW-Bus mit langhaarigen Hippies darin war das Beispiel des staatsfeindlichen Bürgerschrecks par excellence und die Polizei, deren Personalbestand in der Zeit um etwa das Fünffache (!) aufgestockt worden war, reagierte entsprechend.
Die Bedürfnisbefriedigung simpel gestrickter Leute an einfachen Sichtweisen wurde sozusagen auf dem Rücken eines nicht unerheblichen Teils der Jugend ausgetragen. Die Generation der Väter stellte noch immer deutliche Dominanzansprüche an ihre Jugend und war stolz auf das, was sie nach dem Krieg geschaffen hatte. Eigene Vorstellungen vom Leben zu entwickeln kam in etwa einer jugendlichen Unbotmäßigkeit gleich.
Diese traditionelle „Philosophie“ fand ihren verbreitetsten Ausdruck noch immer in der Mitteilung: „solange Du die Beine unter meinen Tisch steckst, wird gemacht was ich sage“ - das bekamen auch junge Erwachsene im Alter von weit über zwanzig Jahren noch oft genug zu hören. Die Enttäuschung der Väter über mangelnde Dankbarkeit und Zustimmung ihrer Jugend, insbesondere deren kritische Haltungen zur Nazi-Vergangenheit der Väter und deren seit der Nachkriegs-Ära stark fokussierte Ausrichtung auf Mehrung ihrer materiellen Besitztümer trugen ihren bedeutenden Teil zu diesen Polarisierungen bei.
Während sich die RAF durch ihre mittlerweile vollends kruden politischen Zielsetzungen und insbesondere durch mörderische Terror-Anschläge vollständig diskreditierte, war es unter den hysterischen Antikommunismus-Kampagnen der Medien ungleich weniger einfach, zu einer kritischen Sicht und Einschätzung der tatsächlichen damaligen weltpolitischen Lage zu kommen. Eine Oppositionshaltung gegen „Atomkraft“ konnte so zu einer gewissen Naivität in der Einschätzung politischer Ambitionen insbesondere der Sowjetunion führen. Viele Menschen - darunter auch ich, wie ich heute einräumen muß - hatten kaum eine Ahnung davon, wie riskant die Lage tatsächlich war. Die bedeutende Rolle damaliger Realpolitiker wie Helmut Schmidt wurde weithin unterschätzt. Zum Glück hat sich das Problem nicht allzuviel später sozusagen von selbst gelöst, indem Gorbatschow die Sowjetunion praktisch demontierte. Die Friedensbewegung hatte in Deutschland jedenfalls Auswirkungen bis weit in die 80er Jahre.
Allein mit der konträren Einstellung zum Thema der atomaren Energiegewinnung machte man sich in den 70er Jahren regelrecht zum Staatsfeind. Massenhaft erscheinende Aufkleber mit „weltanschaulichen Inhalten“ trugen zu demonstrativer Polarisierung bei und waren, wenn man so will, ein weiterer Ausdruck des Zeitgeistes. Ein „Atomkraft - nein danke!“-Sticker zierte 1976 meinen E-Baß-Koffer.

Damals wußte ich - hauptsächlich aus Büchern - etwas darüber, was es mit Rassenhaß, Pogromen, politischen und ethnischen „Säuberungen“ auf sich hat; ich erfuhr allmählich von Dingen wie der „McCarthy-Ära“ oder diversen religiös legitimierten Verfolgungen Andersgläubiger und es kam mir so vor, als könne ich auch einige Lebenslagen von US-amerikanischen Schwarzen ganz gut nachempfinden, denen in der Straßenbahn andere als die per Beschilderung vorgeschriebenen hinteren Plätze verboten waren. In diesem Detail, so fand ich damals, hatten es die Schwarzen allerdings sogar besser, denn von einem wie mir im seinerzeitigen Deutschland wurde es sehr oft als eine Art Provokation empfunden, sich in einer Straßenbahn überhaupt irgendwo hinzusetzen (!).
Erst um die Mitte der 80er ebbte das aggressive Klima allmählich ab. Ich kann es selbst kaum noch glauben, wie abgefahren das da vorher zuging.
Wahrscheinlich überflüssig zu sagen: dies hier war eine Kurz-Beschreibung. Äußerst kurz. Soll aber für jetzt mal reichen.
Rock-Bands wurden auf diesen zu Festen umdeklarierten kollektiven Besäufnissen plastikbechernder Spießer erst im Lauf der 80er Jahre beliebter. Für das „Bier-Image“ hatten sie (die Rock-Bands selbst) immerhin bereits lange vordem gründlichst gesorgt und kamen daher nicht mehr in die Pression, es infolge dieser Sorte von Auftritten erst noch angehängt bekommen zu müssen.
Für ihre musikalischen und „handwerklichen“ Qualitäten gilt dabei im Grunde dasselbe, was ich schon weiter oben für Dixieland-Band angemerkt habe. Allerdings war und ist die Rock-Szene so umfangreich, daß mediokre Amateur-Bands und „Feierabend-Rocker“ das Image der Musik im Allgemeinen nicht wesentlich diskreditieren konnten.
Free Jazz war wesentlich interessanter als Dixie, wurde aber nicht nur hierzulande von Vielen weitgehend mißverstanden, war in seiner Expressivität für viele Ohren schwer genießbar und in seiner politischen Aussage in Mitteleuropa relativ deplaziert. Eine recht eigene politische Dimension hatte Free Jazz eigentlich nur in der damaligen DDR entwickelt, indem er zur einzigen von der Staatsführung offiziell tolerierten Form des Jazz wurde - weil die der ziemlich simpel gestrickten Auffassung war, Free Jazz richte sich politisch gegen das Establishment des kapitalistischen Klassenfeindes. Zum Leidwesen nicht nur vieler Musiker wurde „time-bezogener“ Jazz offiziell nicht mehr geduldet, als die DDR-Führung in den 60er Jahren von der Meinung abrückte, Jazz sei die Musik der in den USA unterdrückten schwarzen Minderheit. In all ihrer mittlerweile stark fortgeschrittenen intellektuellen Isolation beschlossen die selbsternannten, göttergleichen Entscheidungsgewaltigen der DDR-Nomenklatura der idiotischen, weltfremden Ansicht anheimzufallen, daß Jazz außer Free Jazz inzwischen nur noch eine Unterhaltungsmusik für die Weißen sei. Ach so: der US-Weißen. Na ja, auch all der anderen Weißen, also, dieser imperialistischen Klassenfeinde jedenfalls.
* * *
Da hatten es die Polen leichter. Free Jazz war in Polen selbstverständlich auch präsent, spielte aber im Großen und Ganzen keine allzu bedeutende Rolle. Die DDR war ja nun einmal das weltweit einzige Land, in dem Free Jazz zu dem besagten skurrilen Phänomen von „Bastion“ oder „Reservat“ und damit jedenfalls recht eigenartigen Spezialität entwickelt wurde.
Der Staatsführung der „Volksrepublik Polen“ war der Jazz zwar ebenfalls einer Nähe zum kapitalistischen Klassenfeind verdächtig - aber es kamen ja andauernd die neuesten Jazz-Platten nach Polen, weil tausende von polnischen Emigranten sie per Post in ihr Heimatland schickten. Polnische Emigranten leben übrigens derart vorzugsweise in Chicago, daß für diesen Ort das Scherzwort von der zweitgrößten polnischen Stadt nach Warschau gebräuchlich ist. Nun, so und so viele dieser Platten scheinen sogar irgendwie in Polen angekommen zu sein. Eine derartige Anzahl an Emigranten hatten die anderen sozialistischen Bruderländer nun mal nicht aufzubieten. Daher entschloß sich die polnische Staatsführung irgendwann (ich glaube, gegen Anfang der 60er Jahre), den Jazz doch lieber irgendwie zu tolerieren.
Sie hätten andernfalls wohl ihre gesamte Geheimpolizei - die übrigens ebenso wie anderen realsozialistischen Diktaturen in der Bevölkerung einen ganz eigenen, äußerst üblen Ruf hatte - mobilisieren müssen, um diese Musik irgendwie zum Schweigen zu bringen. Man beließ es daher zähneknirschend bei einer Art von Beobachtungsstatus. Wegen einer eigentlich kleinen Sache wie so einer komischen Musik wollte man keinen solchen Aufwand betreiben - wohl auch, um unter der im Unterschied zur deutschen in ihrer Mentalität zu einer gewissen Aufmüpfigkeit neigenden polnischen Bevölkerung keinen unnötigen Widerstand zu provozieren. (Anm.: „Viva Polonia“ von Steffen Möller ist eine sehr amüsante und lehrreiche Lektüre. Möller ist ein deutscher Kabarettist, der in den 1990er Jahren nach Polen emigrierte.)
So hatte Jazz in Polen nicht nur dieses gewisse „westlich-kapitalistische“ und somit subversive Flair, das für die Bevölkerung dem Staat gegenüber etwas Einendes, Solidarisierendes hergab (mindestens so klasse, wie etwa die polnische Spezialität des „möglichst-schlecht-russisch-Lernens“), sondern Jazz konnte in Polen eine regelrechte Blüte erleben. Jazz war einfach da, man konnte allerhand Platten hören und es gab nicht wenige hervorragende polnische Jazzmusiker, die relativ oft live und im Radio zu hören waren. Ich staunte nicht schlecht, als ich etwa 1992 oder so in den polnischen Acht-Uhr-Fernseh-Nachrichten einen ziemlich ausführlichen Live-Bericht von einem zweiwöchigen Jazz-Workshop in der Nähe von Warschau sah, bei dem sich alljährlich traditionell die Creme der polnischen Jazz-Szene versammelt - mit Ausschnitten von Proben, Jam Sessions und allem Drum und Dran. Natürlich wollte ich da auch sofort hinfahren und Leute kennenlernen - was wenig später auch mehrere Male zustande kam. Ich konnte übrigens relativ bald auch mit polnischer Musikterminologie umgehen, denn eigenartigerweise sind sehr viele solcher Ausdrücke wie z. B. „Dur“ und „Moll“ genau dieselben wie im Deutschen. Was im Übrigen eine geradezu krasse Ausnahme darstellt...
Man kann sich vielleicht vorstellen, wie überrascht ich war, als ich 1987 zum ersten Mal und ohne ein Wort polnisch zu sprechen nach Polen reiste und nicht nur feststellte, daß viele Leute deutsch sprachen und ich als Deutscher mit unerwarteter Herzlichkeit aufgenommen wurde, sondern erst recht erstaunt feststellte, daß meine Antwort auf die Frage nach meinem Beruf bei den Leuten dort völlig andere, geradezu gegenteilige Reaktionen hervorrief, als ich das aus dem deutschen Heimatland gewohnt war. Die übliche, fast reflexhafte Gegenfrage, ob man davon leben könne, gab es in Polen einfach nicht. Selbst zukünftige Schwiegereltern ließen sich von der Berufsbezeichnung „Jazzmusiker“ eines Heiratskandidaten für ihre Tochter nicht besonders aus der Ruhe bringen (nicht einmal solche, die sich überhaupt nichts aus Jazz machten). Das lag weniger an einer ausgesuchten, typisch polnischen Höflichkeit - die es allerdings gibt - als daran, daß polnische Jazzmusiker in die Strukturen des gesamten real existierenden sozialistischen Kulturlebens völlig integriert waren. Dies beinhaltete außer diversen Nachteilen den unzweifelhaften Vorteil, daß polnische Jazzer von staatlichen Konzertagenturen mit Auftrittsmöglichkeiten versorgt wurden. Es gab so gut wie keine Arbeitslosigkeit - eben auch nicht bei Jazzmusikern. Cool, nicht?
Es existierte eine privilegierte Kaste von Leuten mit bestimmten Berufen, die ins kapitalistische Ausland geschickt wurden, um dort zu arbeiten (manche Ingenieure usw.). Die Spitzen der polnischen Jazz-Szene gehörten auch dazu und konnten weltweite Tournéen absolvieren - vor allem wenn sie entsprechende Beziehungen zu Parteifunktionären hatten. Dies galt insofern eigentlich für Alle und Jeden, jedoch war es im Polen der Zeit „unter der Kommune“, wie man dort zu sagen pflegte, immerhin nicht ganz ausschließlich zwingend notwendig. Nebenbei bemerkt sehe ich, daß sich in Deutschland mitten im tollsten Kapitalismus sehr ähnliche Strukturen im Zusammenhang mit diversen Institutionen und Funktionären gebildet haben und rasant ausbreiten - eben auch in der Jazz-Szene.
Ostblock-Jazzer hatten im Westen noch einen Exoten-Bonus. Selbstverständlich nutzten manche polnische Musiker damals die Gelegenheit, um von Tournéen nicht wieder ins sozialistische Polen zurückzukehren. Jedenfalls dürfte dies alles einigermaßen erklären, warum wir schon lange vor der Wende besonders viele Namen von polnischen Jazzern kannten.
Ich erinnere mich an eine Begegnung mit dem russischen Bassisten Viktor Dvoskin um 1992 in Moskau, bei der er mir voller Stolz sein Info zeigte, das eine seitenlange Auflistung seiner Auftritte bei internationalen Jazzfestivals usw. enthielt. Ich gestehe, daß ich zwar zu der Zeit bestimmt nicht in Rußland hätte leben mögen, aber dennoch etwas neidisch auf diese Liste war...
Polnische Jazzer kamen also mit westlichen Devisen heim, wurden zwar unverzüglich nach ihrer Rückkehr vom Heimatstaat unverschämt ausgeplündert, konnten aber mit dem kleinen Rest des Geldes, das sie behalten durften, für dortige Verhältnisse immer noch als ungewöhnlich reich gelten. Das sog. Währungsgefälle war immens. Ein paar Mark waren ein Haufen Geld. Von all diesen Umständen hatte ich, als ich 1987 zu einer ersten Tour dorthin eingeladen wurde, natürlich keine Ahnung. Alles war wahnsinnig interessant; das Währungsgefälle war allerdings bestürzend. Mir einiger Unsicherheit glaube ich mich an Monatslöhne im Schwarzmarkt-Umrechnungswert von etwa DM 20.- zu erinnern. Allerdings waren viele Dinge für unsere Verhältnisse unfaßbar billig - selbst im Verhältnis zu diesen Monatslöhnen.
Eine Straßenbahnfahrt kostete sechs Zloty und das war ein solcher Bruchteil eines Pfennigs, daß ich ihn nicht nachgerechnet habe. Nicht unähnlich war es ja mit anderen Dingen, die „im Westen“ teuer waren - wie Miete und Energiekosten. Dennoch löste es lautstarke Proteste aus, als der erwähnte Fahrkartenpreis 1988 von sechs auf neun Zloty erhöht wurde. Obwohl eigentlich ein Nachbarland, war eigentlich fast alles anders und wo es das nicht war, gab es oft überraschende Gemeinsamkeiten. Manches konnte einem das Gefühl einer Zeitreise ins Deutschland der 1950er Jahre geben. Es war wirklich exotisch. Ich wollte allerdings auf keinen Fall den „reichen Onkel aus Übersee“ abgeben - was mitunter nicht ganz leicht war. Denn schließlich war ich das daheim auch nicht - ganz bestimmt nicht.
Nicht lange darauf sollte sich „die Wende“ ereignen - was natürlich fast niemand ahnte - und mit der Auflösung des real existierenden Staatssystems wurden auch die Konzertagenturen geschlossen. Die polnischen Musiker mußten ihre Arbeitsmöglichkeiten plötzlich selbst akquirieren und das war für die Meisten zumindest anfangs verdammt bitter.
Im Westen war man dies ja schon gewohnt. Plötzlich und zumindest in der ersten Zeit nach der Wende hatten sich die Lebensumstände und Arbeitsbedingungen in Polen dramatisch verschlechtert. Die aus der „Kommune“-Zeit ererbten mafiosen Strukturen drohten außer Kontrolle zu geraten. Es wurde zum Glück nicht so schlimm, wie zum Beispiel im Rußland der Ära von Jelzins Tochter. Und Polen wäre nicht Polen, wenn sich die zuvor schwer angeschlagene Kultur-Szene nicht relativ bald wieder wenigstens einigermaßen erholt hätte..
Aufgrund des Staatssystems und der politischen Strukturen dürfte das kulturelle Leben in anderen dieser mittlerweile ex-sozialistischen Länder zumindest ähnlich organisiert gewesen sein. Ich weiß jedoch nur etwas über die Verhältnisse in Polen, denn insbesondere durch die 1988 geschlossene Ehe mit einer Polin konnte ich - obwohl wir nicht dort, sondern in Deutschland lebten - außer der Landessprache noch vieles über „Land und Leute“ lernen bzw. kennenlernen. Auch mit diversen polnischen Musikern konnte ich zusammenarbeiten. Obgleich die Ehe längst nicht mehr besteht und ich nicht mehr so oft nach Polen reise, habe ich noch eine intensive Beziehung zu diesem Land. Polska da się lubić - Polen kann man mögen!
* * *
Free Jazz hatte außerdem den Nachteil, daß seine Radikalität besonders vielen ideologischen Schwärmern und Wichtigtuern imponierte. Das Phänomen würde sich, wenn Free Jazz nicht so ein „Insider“-Genre wäre, zum sogenannten Bilderbuchbeispiel eignen, denn es findet sich ja bekanntlich auf identische Weise im Zusammenhang mit allen möglichen Gebieten der Kunst wie auch in Religion, Politik, Philosophie und so weiter.
Eine bedeutende musikalische Problematik entstand dadurch, daß sich gleich zu Beginn Zeit der Free Jazz- Modewelle in den späten 60er Jahren viele Profilneurotiker und Möchtegerne einmischten und dazu beitrugen, flächendeckende Abschreckung zu verursachen. Die Musik wurde zum Beispiel oft als egozentrierte Selbstverwirklichungs-Plattform in eigentlich unvereinbarer Kombination mit einer Art instrumentalem Kommunikationstraining zelebriert, was in ewig langen, ekstatischen Fortissimo-Sequenzen dem fragilen Image des Free Jazz den Rest gab.
Es waren eher seltene Momente, in denen substantiell hochwertige und interessante Free Jazz Acts gehört werden konnten. Sie fanden auf wenigen um Seriosität bemühten Festivals und in Clubs und statt, die darauf spezialisiert und eingeschworen waren, jedoch kaum Einfluß auf landläufige Meinungen haben konnten. Das Image von „Jazz“ war durch Free Jazz allerdings allgemein und rundum in Mitleidenschaft gezogen worden und hat sich in weiten Kreisen der Bevölkerung davon bis heute nicht erholt. Jazz wird vielfach immer noch entweder eben damit gleichgesetzt - oder mit Dixie. Ich möchte diese Feststellung einmal so stehenlassen, obwohl die Betrachtungen, wie ich wohl weiß, differenzierter sein könnten. Ein „Standard-Image“ zu etablieren, ist bekanntlich jedenfalls leichter, als es wieder loszuwerden.
Als kleine Anekdote zum Thema möchte ich hinzufügen, daß ich bei einem Gig mit einem „Gitarren-Trio“ einmal gefragt wurde, ob „das jetzt auch Jazz“ sei. Weil - es sei ja „kein Saxophon dabei“.
Erstaunlich gut läßt sich auch daran beobachten, wie schnell beziehungsweise nachhaltig irgendwelche Eindrücke normative Qualitäten bekommen und sich als „Standards“ in den Köpfen festsetzen können.
Wir sind hier auch in die Nähe einer verbreiteten „Image-Facette“ des Jazz geraten, die sich in oft geäußerten Vorstellungen über moderneren Jazz als einer „intellektuellen“ Musik ausdrückt - praktisch ausschließlich in dem Sinn gemeint, daß diese Eigenschaft dem Genuß der Musik hinderlich sei. Ich finde natürlich, daß man es sich mit dieser Behauptung zu leicht macht und sehe als Hintergrund dafür vielmehr ein zusehends verbreitetes Verständnis von Freizeit und Freizeitgestaltung, nach dem „Mühelosigkeit“ zu hoher und höchster Priorität erhoben ist (allerdings, wie sich von selbst versteht, mit der großen Ausnahme von sportlichen Betätigungen). Darüber hinaus sehe ich zumindest im Bereich Musik eben auch diese von alters her ererbte und überlieferte Neigung - um mit dem großen (und von mir besonders verehrten) Wihelm Busch zu sprechen - gerade „im anmutvollen Kunstgebiet“ von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung zu haben. Busch schrieb 1883 im Prolog zum „Maler Klecksel“ so schöne Zeilen wie:
„... Vor allen der Politikus
gönnt sich der Rede Vollgenuß;
und wenn er von was sagt, so sei´s,
ist man auch sicher, daß er´s weiß.
Doch andern, darin mehr zurück,
fehlt dieser unfehlbare Blick.
Sie lockt das zartere Gemüt
ins anmutvolle Kunstgebiet,
wo gerade, wenn man nichts versteht,
der Schnabel um so leichter geht. ...“
In dem Sinne möchte ich zu meiner persönlichen Lebenssituation als Künstler notieren, daß mir, ohne im Geringsten pessimistisch zu sein, selbstverständlich klar ist, nicht unbedingt eine flächendeckende Wirkung mit meiner anmutvollen Musik zu erreichen, sondern vielmehr ein gewisses Publikum, das aus ganz eigenem individuellen Hintergrund für dies und jenes aufgeschlossen ist sowie möglicherweise bereits Erfahrungen mit dem Genre hat, dem es somit zuneigt bzw. zuspricht. Man kann es nicht Jedem recht machen. Ich möchte das alte Sprichwort allerdings auch so verstehen, daß damit in positivem Sinn einer Art von Vielfalt Rechnung getragen sein kann - wohl wissend, daß dies im Gegensatz zu meinen Wünschen der Realität nicht ganz entspricht. Zum Glück bin ich weder wirtschaftlich noch charakterlich dazu gezwungen, allzu populistisch zu werden, aber im gleichen Zuge finde ich, daß man es durchaus unternehmen soll, ein Publikum zu unterhalten. Der Aspekt liegt jedenfalls im Bereich meiner künstlerischen Intentionen und wäre mir alles andere als unwichtig - auch wenn davon in meinem geliebten „anmutvollen Kunstgebiet“ grundsätzlich mehr zu hören als zu sehen ist.
Es kommen immer mal wieder Leute aus dem Publikum auf mich zu mit Äußerungen wie: „...also das war jetzt Jazz? Ich bin ja überrascht, weil´s hat mir ja doch gefallen“. So etwas freut mich halt jedes Mal - „doch“ hin, „doch“ her.
Nur - leben kann man davon nun auch wieder nicht, heutzutage. Weder, was die Intention angeht, ein gewisses Publikum zu erreichen, also sozusagen „für Leute zu spielen“, noch in finanzieller Hinsicht. Nun, ich sagte es ja wohl bereits: ich spiele ja nicht nur Jazz...
Um noch ein wenig zu „allgemeinerer Historie“ zu kommen: über die Versuchung, bei zeitgeschichtlichen Beschreibungen in Dekadenstrukturen zu verfallen, sollten einige Worte gesagt werden. Eine solche - mitunter auch meinerseits verspürbare - Versuchung gibt es offenbar. Man blickt vielleicht auf etwas zurück, das z. B. „in den 70ern“ passierte - und steckt das dann leicht in eine „Zeit“ im Sinne einer Periode, die historisch so möglicherweise nicht korrekt ist. Dekaden drängen sich dem erinnernden Denken geradezu auf. Es ist andererseits offensichtlich, daß Geschehnisse und Entwicklungen sich nicht an Dekaden-Strukturen halten, sie beginnen nicht hübsch sauber mit einem neuen Jahrzehnt und bemühen sich auch nicht, mit demselben pünktlich zu enden. So gab es Musik-Stile oder Moden und andere Bewegungen nicht nur innerhalb solcher Jahrzehnte-Wendungen. Ich muß bei solchen Betrachtungen unwillkürlich an Werke über Jazz von Joachim Ernst Behrendt denken - er hatte für den Verlauf von Strömungen und Entwicklungen im Jazz recht deutliche Dekaden-Strukturen behauptet, die ich stark bezweifeln möchte. „Bebop“ zum Beispiel dachte solcher Thesen zum Trotz überhaupt nicht daran, erst 1950 zu beginnen und 1960 wieder beendet zu sein. Man konnte und kann das anhand diverser authentischer Quellen und Tonträger ohne Weiteres nachvollziehen.
Meine historisierenden Anmerkungen sind also auch in diesem Sinne gedacht und gemeint, wenn ich z. B. von „90er Jahren“ spreche.
Jedenfalls gab es in der Jazzgeschichte von den 1960er Jahren im Übergang zur folgenden Dekade große Änderungen. Der Kreis von Musikern, die den Modern Jazz der 60er weiterentwickelten wie auch das Publikum dafür war in der Zeit der Jazz/Rock/Soul-Fusionen der 70er Jahre relativ klein geworden.
Warum auch immer - ich zählte jedenfalls auch dazu, seit ich diese Musik für mich entdeckt hatte.
Ich glaube, diese Musik lebt sozusagen in und aus einem ganz besonderen Geist - es war eine ganz besondere Inspiration in dieser Zeit und unter den "führenden" Musikern dieser Zeit und ich empfinde in der Tat eine besondere Ernsthaftigkeit in der Art und Weise, mit der diese Musik komponiert und gespielt wurde. Wirklich - ich empfinde in diesem nordamerikanischen Jazz der 1960er Jahre tatsächlich einen ganz besonderen "Spirit"; ich hätte gern dazugehört und wäre insofern eigentlich gern etwas früher geboren worden...
Traditionelle Jazz-Stilrichtungen waren jedoch, wie bereits angedeutet, etwas populärer und wurden insbesondere in Mitteleuropa durchaus gepflegt.
Das Publikum dafür war zwar nur wenig zahlreicher, dafür aber zahlungskräftiger - es bestand vielfach aus Akademikern, in deren Studentenzeiten in den 50ern der Swing die Pop-Musik der Jugend war - was sich als Auswirkung der Nazi-Diktatur und darauffolgender kultureller Einflüsse der US-amerikanischen Besatzungsmacht ergeben hatte. Die Rock´n´Roll-Bewegung stand im Europa der späteren 50ern erst am Anfang ihrer Verbreitung.
So hatte ich in den 80ern und 90ern einige Jobs bei fünfzigsten und sechzigsten Geburtstagen von Leuten, die sich (inzwischen) aufwendigere Empfänge leisten konnten und für die, wie gesagt, der Swing eben die Musik ihrer Jugendzeit war. Ich fand das natürlich hochinteressant, ließ mir dies und das erzählen, stellte aber bald etwas enttäuscht fest, daß das Interesse für Jazz recht konservativ bei relativ traditionellen Stilrichtungen stehengeblieben war. Zudem gab es eine ziemlich verächtliche Haltung gegenüber dem Rock´n´Roll („primitiv“) und dito gleich auch noch zu sämtlichen späteren Entwicklungen der Rockmusik-Geschichte. In solche Gespräche brachten einige dieser Swing-Fans eine ziemlich deutliche einverständnisheischende Attitude ein, die mir natürlich gewisse Beklommenheiten verursachte.
Wo ich meine differierende Meinung offen zur Sprache brachte, war jedenfalls meine Reputation als Jazzmusiker in unmittelbarer Gefahr, um nicht zu sagen: meistens im Eimer. Mit moderneren Entwicklungen in Jazz und Rock hatte man also nichts im Sinn, aber zumindest in Deutschland waren diese Leute die einzige mehr oder weniger bildungsbürgerliche Bevölkerungsschicht, die wenigstens nicht alles außer „Klassik“ in einen Topf warf. Durch ihre gesellschaftlichen Positionen verhalfen sie dem „Jazz“ zu einer gewissen Salonfähigkeit - was indirekt unter anderem dazu beitrug, daß Jazz als Studienfach Eingang an vormals rein klassisch orientierten Musikhochschulen fand. In einigen Ländern gab es das bereits; in Deutschland fand es mit einiger Verspätung statt, denn das (deutsche) „klassisch“ orientierte Bildungsbürgertum hatte erst im Laufe der späteren 80er Jahre damit begonnen, seine bis dahin übliche versteinerte Arroganz zu überwinden.
Dazu möchte ich anmerken, daß ich auch einen großen Teil der „klassischen Musik“ sehr schätze - schließlich habe ich an Musikhochschulen in Karlsruhe und Mannheim entsprechende Studien absolviert. Mit jüngeren musikhistorischen Entwicklungen auf diesem Gebiet - „neue europäische Konzertmusik“ oder wie man es auch immer nennen sollte - habe ich mit allerdings weniger beschäftigt. Auch deshalb konzentrieren sich die vorliegenden Betrachtungen auf andere musikalische Bereiche.
Im Übrigen bin ich in einem der Häuser dieses „klassisch orientierten Bildungsbürgertums“ aufgewachsen und habe eben davon in Vielem - beispielsweise an Inspirationen, bestimmten Denkungshaltungen und nicht zuletzt an Bildung immerhin sehr profitiert. Dagegen hat mir Einiges an Inhalten, die meine Sozialisation mir vermitteln wollte, bereits in relativ jungen Jahren weder besonders eingeleuchtet noch gefallen - was so weit betrachtet natürlich nichts großartig Ungewöhnliches wäre. Nun, auch für mich gehörten einige Einflüsse der US-amerikanischen Kultur zu bedeutenden Inspirationen meiner Jugend.
In Bezug auf Jazz und Rock stand die durchschnittliche Wertschätzung unter der älteren Bevölkerung in Deutschland in beträchtlichem Gegensatz zu der Anbetung, die praktisch allen anderen amerikanischen Errungenschaften entgegengebracht wurden. Für mich dagegen spielte die Musik die bedeutendste Rolle. Zunächst bestand die übrigens eher in englischer Rockmusik als in amerikanischem Jazz, mit dem ich erst im Alter von etwa siebzehn Jahren in nähere Berührung kam. Ich habe, nebenbei bemerkt, oft gerätselt, ob das vielleicht unter Anderem eine Art regionale Ursache gehabt haben könnte - schließlich war Jazz im amerikanisch besetzten Süddeutschland wesentlich präsenter als in anderen Regionen.
Entsprechende, die deutsche Gesellschaft prägende Einflüsse wirkten sich selbstverständlich nicht gänzlich getrennt nach den Regionen der jeweiligen Besatzungsmächte aus, aber deren Musik hatte doch über einen weiten Teil der Nachkriegszeit für das, was im deutschen Radio gebracht wurde, eine recht bedeutende Rolle gespielt.
Ich bin in Goslar am Harz aufgewachsen, also in einem vorwiegend englisch besetzten Teil Deutschlands. Hier war englisches Militär zwar weniger zahlreich stationiert als das amerikanische im Süden, verfügte aber dennoch über eine gewisse Präsenz. Und die Tommies standen mehr auf Rock. Und auf Dixieland - es gab im England der späten 1940er bis in die 60er Jahre eine recht bedeutende „Revival“-Bewegung für solche Musik, zu deren Protagonisten zum Beispiel Acker Bilk, Ken Coyler, Chris Barber und Monty Sunshine gehörten.
Ich fand Jazz super - spätestens, seit ich als etwa zehnjähriger Knabe einmal auf dem Goslarer Marktplatz eine Dixieland-Band gehört hatte. Ich erinnere mich, daß die Jungs nicht deutsch sprachen - vielleicht war es ja eine englische Band?
Der Kontrabaß hatte es mir besonders angetan. Aber auch der Bläser-Sound. Ich kannte immerhin die Instrumente Posaune, Trompete, Klarinette, wußte auch, daß das andere ein Saxophon war, was der Klarinettist manchmal spielte (aber nicht, was für eins). Obwohl die Band Themen von Songs gespielt haben dürfte, erinnerte ich mich an kein einziges davon, wohl aber an das eigentümliche Klanggewebe der drei Bläser, die alle gleichzeitig und alle etwas Unterschiedliches spielten, was aber immer irgendwie zusammenpaßte. Das ging mir noch viele Tage lang im Kopf herum und veränderte sich auch - etwa so, wie Dinge sich ändern, wenn man durch ein Kaleidoskop schaut und es dabei dreht.
Das Beste war der Baß, der die Band immer irgendwie antrieb mit diesen tiefen Tönen. Wahrscheinlich war ein Banjo dabei, an das ich mich aber überhaupt nicht erinnerte - die Banjospieler mögen es mir verzeihen.
Leider lief so was ganz, ganz selten im Radio.
 Rock war ganz klar das angesagte Ding - der Meinung war ich letzten Endes ebenso. Es gab tägliche Sendungen mit echtem, harten Rock (nein, nicht so´n Pop-Kram, das war mehr was für Mädchen), die wir im Zeitalter der Spulentonbandgeräte immer mitzuschneiden versuchten.
Wie ich erst später bewußt erkennen konnte, werden mit Musik nicht nur Klänge, sondern auch Lebenseinstellungen und Weltsichten transportiert. So haben mir vor allem einige Aspekte des US-amerikanischen Begriffes von Freiheit besonders imponiert, die ich im Übrigen späterhin in ihrer spezifischen Ausprägung für einen für die nordamerikanische Kultur typischen und positiven Bestandteil gehalten habe. Das prägte indirekt, aber in einem gewissen Maß zum Beispiel meine Haltung zur Unverzichtbarkeit individueller improvisatorischer Kreativität im Kontext von sozialen Gemeinschaften - kurz gesagt. Trotz sehr vieler Konterkarierungen und Pervertierungen, trotz maßloser Intoleranz, Bigotterie, imperialistischer Anmaßung und anderer massiver Gefährdungen der Freiheit im eigenen Land wie erst recht im Zusammenhang mit ihren gräßlichen Auslands-Interventionen empfinde ich in dieser nordamerikanischen Musik Elemente eines Freiheitsbegriffes, der mir früher schon irgendwie imponiert und eben auch für mein eigenes musikalisches Wirken eine Rolle gespielt hat.
Es ist also ganz klar: ich steh auf Jazz.
Und außerdem übrigens noch auf Tomatenketchup.
Ersteres ist eine Kunstform, und zwar - wie schon oft konstatiert wurde - bislang die einzige eigenständige Kunstform, die auf nordamerikanischem Boden entstanden ist.
Nun ist auch Tomatenketchup auf nordamerikanischem Boden entstanden, aber dabei handelt es sich - wenigstens das dürfte ja klar sein - eigentlich nicht um eine Kunstform.
Irgendwann habe ich nach einigen Überlegungen beschlossen, wegen dieser Dinge nicht nach USA überzusiedeln. Zumal mir der Markt für beide Produkte in den USA noch überlaufener zu sein scheint als hierzulande. Außerdem ist das "Gottes eigenes Land", wie ich gehört habe - "Gods Own Country", jawohl! Daran kommt man schwer vorbei. Deshalb habe ich vielmehr beschlossen, beides hier drüben herzustellen bzw. mir quasi konsumierend zuzuführen - je nachdem.
Zum Glück haben sie dort drüben im Ami-Land endlich einen aus anderem Holz geschnitzten Präsidenten. Das Land hat in seiner Geschichte zwar schon diverse unfähige Präsidenten verkraftet, aber noch so einer vom Schlag eines Reagan oder insbesondere dieses religiös illuminierten Kriegstreibers Bush Junior hätte es jetzt ganz sicher ruiniert. Die ehemalige Supermacht ist nach meiner Überzeugung knapp darum herumgekommen.
Aber es wird schwierig. Wenn ich bloß an solche grausigen Republikaner-Typen wie Dick Cheney oder diese ultra-bescheuerte "Tea-Party-Bewegung" denke...
Als Barack Obama am 10.12.2009 den Friedensnobelpreis erhielt, gab es während der Zeremonie auch einen musikalischen Programmpunkt, der auf Obamas Wunsch von einer Trio-Besetzung um Esperanza Spalding bestritten wurde. Allein dies kann recht eindrucksvoll belegen, daß der Mann eines anderen Geistes Kind ist als z. B. die meisten seiner Vorgänger.
Die Nobelpreisverleihung wurde übrigens live im ZDF übertragen - auf trivialem Niveau und etwa im Stil einer Reportage über eine Monarchen-Hochzeit. Während des musikalischen Teils erlaubte sich der Reporter, irgendwelche Platitüden über Esperanza und ihre Musik in den Schluß eines Musikstückes hineinzuquatschen, die in der frei erfundenen Feststellung gipfelten: „... und sie war bereits mit 15 Jahren Konzertmeisterin.“ Offenbar hatte der Holzkopf den Eindruck, (ausgerechnet) er müsse hier erklären, warum dies jetzt gute Musik gewesen sei. Die Befriedigung trivialer Bedürfnisse - wohl auch der eigenen - nach schlichten Superlativen und „Star-Klischees“ stand deutlich im Vordergrund. Auch wenn es angesichts des Großen und Ganzen nicht von allzu großer Bedeutung ist, stellt so ein Reportage-Stil ein ärgerliches Armutszeugnis dar.
Ich will noch einmal auf dem Umgang mit ausländischer Musik im Deutschland der Nachkriegsjahre zu sprechen kommen.
Daß amerikanischer Jazz für die Jugend der 50er Jahre eine Bedeutung bekam, die auch aus der unmittelbar vorangegangenen Geschichte der Nazi-Diktatur erwuchs, ist sicherlich nicht die ganze Erklärung. Für die Jugend war die Musik freilich auch ein Vehikel zur Opposition gegen die Generation der Älteren, die ja unter Anderem als Täter und Mitläufer des NS-Regimes und Verursacher des Krieges gesehen wurden. Aus dieser Ablehnungshaltung und der Hinwendung zu amerikanischer Musik der Nachkriegszeit kann man, wenn man will, sicherlich Elemente der Vorgeschichte der Protestbewegung der Jugend der 60er Jahre erkennen. US-amerikanische Musik und wenig später auch solche, die in England entstand, gab Jugendlichen bis in die 80er Jahre einen Identifikationsrahmen für ihre Weltanschauungen, für politische Haltungen und Oppositionskonflikte mit der Elterngeneration. Für spätere Jugend-Generationen spielte Musik allmählich nicht mehr dieselbe Rolle; Wandlungen dieser Strukturen dürften sich wohl am deutlichsten aus gesellschaftlichen Entwicklungen unter dem Einfluß der jüngeren internationalen Wirtschaftsgeschichte erklären lassen. Der Aspekt des Entertainment ist im Musik-Konsum sehr stark in den Vordergrund getreten. Musik wird eher als eine Art „Tapete“ im Sinn von Ambiente-Gestaltung und unter sonstigen Lifestyle-Elementen als Ausrüstungsbestandteil behandelt und dient weniger dem Zuhören.
Um das hier einmal so dahingestellt sein zu lassen und zu anderen Themen zurückzukommen, sei abschließend noch die Begebenheit zitiert, die der Musiker und Journalist Ekkehard Jost neulich in einem Interview zum Besten gab.
Es ging um eine Gig-Situation im Norddeutschland der Zeit um 1960. Die Band spielte in irgendeinem Lokal und ließ es sich einfallen, ein paar Jazz-Titel zu spielen. Daraufhin kam der Wirt mit der Aufforderung zur Band, sie sollten unverzüglich wieder „etwas Anständiges“ spielen und dieses „Niggergejiddel“ unterlassen. Was für ein entsetzliches Wort...
Ich bin zwar etwas später geboren, habe aber ebenfalls Worte wie „Urwaldmusik“, auch „Negermusik“ noch reichlich oft zu hören bekommen. Am meisten hat mich das Wort „Bumsmusik“ fasziniert, das zum verbreiteten Vokabular der Zeit gehörte. Ich jedenfalls habe es - insbesondere in Bezug auf Rockmusik - oft gehört. Es ist zum Glück gleichfalls aus der Mode gekommen. Schließlich würde es heute gründlichst mißverstanden werden.
Zu diesem und dem vorangegangenen Thema gehört, daß mir auch der in typisch US-amerikanischer Weise unprätentiöse, vorurteilslose Umgang mit dem Musikgeschmack anderer Mitmenschen gefällt, ja sogar wiederum imponiert. Dieser Umgangsstil mag zum Teil an einer gewissen Gleichgültigkeit liegen, die es dort in der Hinsicht sicherlich gibt, aber jedenfalls erregt es in den USA weder besonderen Argwohn noch Geringschätzung, wenn Jemand gleichzeitig auf Punk, Irish Folk, Jazz und asiatische Opernmusik steht. In Europa, zumal in Deutschland, ist dergleichen unvorstellbar.
Inwiefern mir persönlich so eine tolerante Haltung mißlingt, habe ich bereits anhand eines Beispiels weiter oben erwähnt. Allerdings will ich es mir in diesem Fall trotzdem nicht vorwerfen. Nicht einmal sozusagen im Lichte der gerade vorangegangen Betrachtungen, denn eine in auch nur einigermaßen hinreichender Reflexion begründete Ansicht recht unbefangen bis vorbehaltlos offen zu äußern und Anderen dasselbe zuzugestehen, ist mir sehr wichtig. Ich will niemanden verletzen, aber ich habe etwas gegen unaufrichtige Schönfärbereien. Und das, meine ich, ist wiederum eher etwas Europäisches.
*
Im Laufe der auf die 70er Jahre folgenden Zeiten wurde Pop immer kurzfristiger mit fast allem gemischt, was zu bekommen war - natürlich auch mit Mischungen, die gerade kurz vorher entstanden waren. Mitunter griff man historisch ähnlich weit zurück wie in der textilen Modebranche - ich hatte zumindest was das angeht immer gehofft, wir hätten gewisse Design-Scheußlichkeiten der 70er hinter uns...
Es kann jedenfalls keine Zweifel daran geben, daß diverse aktuelle Bands - insbesondere aus dem „Indie-Rock“-Bereich - tatsächlich fast genauso wie in den 70ern klingen. Zwar herrscht allenthalben ein starker „Innovationsdruck“ (der zeitgeistprägend offenbar aus Industrie und Wirtschaft hervorgegangen ist) aber zumindest im Rock-Pop-Bereich fällt anscheinend niemandem besonders auf, daß viele junge Bands alles andere als neuartig und gewiß erst recht nicht „modern“ klingen.
Ein Band-Sound wie ihn z. B. „Cold Play“ offenbar ziemlich erfolgreich (re-)präsentiert, klingt für meine Begriffe nach absolut „kaltem Kaffee“ - „Cold Coffee“ wäre also ein passenderer Titel - zumal das Zeug, wie soll ich sagen, nicht mal für fünf Cent losgeht. Ich kann es nicht anders sagen: die Musik „groovt wie eingeschlafene Füße“. Irgendjemand muß mir noch erklären, was daran so cool sein soll (etwa, daß die Band ihre komplette CD zum freien Download ins Internet gestellt hat?).
Im Pop-Business wird vieles als irrsinnig authentisch, ja „kultig“ vermarktet und damit ist die Frage, ob das jetzt zum Beispiel auch noch und überhaupt innovativ sei, eigentlich von vornherein vom Tisch. In der Jazz-Szene wird das Stichwort „innovativ“ ständig wie ein Bauchladen oder in der Art eines Schildes vor sich her getragen - zuweilen eher im Sinne von Schutzschild, ein andermal eher von Hinweisschild - und erfolgreich jedenfalls insbesondere von Kritikern lamentierend und mahnend ins Spiel gebracht. Offenbar ist man im Einsatz diesbezüglicher Präsentationsstrategien im Jazz-Business nicht so geschickt wie in der Pop-Szene...
Ein kleines weiteres Beispiel soll hier noch hinzugefügt sein: unter Bewerber-Einsendungen von Hörbeispielen zum „Neuen Deutschen Jazz-Preis Mannheim“ finden sich (mittlerweile) nicht selten Sachen von außergewöhnlichem Niveau. Andererseits scheinen allerhand Bands zu existieren, die insbesondere bei stilistischer Ausrichtung auf Jazz-Rock-Fusionen mitsamt ihrem oft enthaltenen „Punk-Funk“-Einschlag so weitgehend ähnlich z. B. zu meinen ersten Jugend-Bands aus der Ära der frühen 70er Jahre klingen, daß mir rätselhaft ist, wie man solches Zeug als innovativ, kreativ und modern titulieren kann.
Es klingt in meinen Ohren so, als sei die Musik wohl eher nicht so bekannt, die vor 30 Jahren schon einmal fast genauso klang und so kommt es mir vor, als versuchten hier ein paar Leute, das Rad noch einmal zu erfinden. Daher klingt es oft auch so merkwürdig unauthentisch. Da hört man zuweilen Sekundär-Kopien von willenlos durcheinandergewürfelten, oberflächlich zitierten Versatzstücken, die hinten und vorn nicht zusammenpassen - ja, ist leider so. Eigene Ideen hängen nun mal im luftleeren Raum herum, wenn sie keine Basis haben. So klingt das dann eben. Gerade wie es Germanistikstudenten im fünften Semester geben soll, die vor lauter Sekundärliteratur Lessings Nathan als „der Waise“ mit „ai“ schreiben, gibt es Jazz-Studenten, deren Bildung mehr oder weniger vorsätzlich nicht einmal bis zu „Weather Report“ zurückreicht - das ist zum Beispiel eine verbürgte Erfahrung meines Freundes, des Saxophonisten Ralf Rothkegel in seiner Eigenschaft als Professor für Jazz-Geschichte an der Musikhochschule in Leipzig.
Manche Leute klingen mir so, als stünden hinter individuellen Wünschen, Musiker zu sein (womöglich mit dem Alibi eines diplomgekrönten Jazz-Studiums) das mehr oder minder bewußte Motiv, angesichts aktueller, allgemein schwieriger sozio-ökonomischer Bedingungen eine passende Alternative zu „bürgerlicheren“ beruflichen Perspektiven zu finden. Anders ausgedrückt: in Zeiten mancher längst bestehender oder auch neuerer Aussichtslosigkeit diverser beruflicher Perspektiven kann man vielleicht dazu neigen, sein Hobby zum Beruf machen.
In den letzten zwanzig Jahren hat der vielzitierte „Turbo-Kapitalismus“, seit er „meist im Gewand von Casino- und Raubtier-Kapitalismus einhergeht“ (Anm.: Zitat aus „Die Angst des weißen Mannes“, Peter Scholl-Latour, Propyläen Verlag 2009), seine Faszination und Reputation ziemlich weitgehend eingebüßt. Und der „Klassenkampf von oben“ ist sozusagen in vollerem Gange, als es Vielen jetzt schon bewußt ist. Zusammen mit besagten eher sozio-ökonomisch begründeten Perspektiven an branchenspezifischen Aussichtslosigkeiten trägt dies sicherlich viel dazu bei, daß alle möglichen modernen Berufsbilder als Perspektive für einen jungen Menschen von vornherein ein deutliches bis massives "Angeödetsein" verursachen können.
Nicht zuletzt sind gewisse Vorstellungen von einem künstlerischen Beruf in ihrer Faszination noch ungebrochen - wer sich die Alternativen vorstellt, auf „Brettern, die die Welt bedeuten“ zu stehen oder in einem Büro zu verenden, wird das sicherlich bestätigen wollen. Der Erfolg solcher TV-Kreationen wie „Deutschland sucht den Super-Star“ (sollte vielleicht: besser heißen: den „Super-Idioten“) spricht für sich.
Also „lieber Saxophon als Betriebswirtschaft“ - oder so ähnlich? Falls das zuträfe, könnte ich es zwar gut verstehen, müßte aber gleich hinzufügen, daß es für die Meisten höchstens zu einem Musikschullehrer-Dasein reichen würde - oder sagen wir doch gleich: wird. Ich wiederhole: höchstens. Ausgedehnte, nachhaltige und substantielle musikalische Arbeit mit entsprechender Bühnen-Präsenz wird für das Gros der angehenden Musiker eine Illusion bleiben - noch schlimmerenfalls zu einer solchen werden. Was bekanntlich nicht einmal mit den individuellen Qualitäten des Musikers zu tun haben oder in irgendeinem Verhältnis dazu stehen muß.
Beziehungen zu knüpfen war in diesem ganzen Business schon immer entscheidend. Früher nannte man das wohl scherzhaft „Vitamin B“, aber das war irgendwann anscheinend nicht mehr so richtig „korrekt“. In noch höherem Grad gilt das für den kurz nach dem Zusammenbruch der DDR-Diktatur aufgekommenen Ausdruck „Seilschaften“. Das der Computertechnologie entlehnte Wort „Netzwerk“ bedeutet aber im Grunde dasselbe und ist durch seine Etablierung in der Industrie- und Wirtschafts-Szene so salonfähig geworden, daß es endlich in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist.
Wir erleben seit einiger Zeit, so sehe ich es, auch im Jazz-Bereich einen Aufschwung der Bedeutung von Institutionen und Funktionären bei der Vergabe von Aufträgen. Damit meine ich nicht nur staatliche Institutionen, sondern z. B. auch durch Sponsoren geförderte Projekte, die von deren Organisatoren in zunehmend streng geschlossener Günstlingswirtschaft verwaltet werden. Das wird klarer, wenn man versucht, irgendwo „reinzukommen“ - und sei es nur, um seine Band für einen einzigen Auftritt unterzubringen. Manchmal hat man es dann mit einem monarchisch eingestellten „Macher“, manchmal mit einer Clique zu tun. Wenn man Jemanden in dem Dunstkreis ein wenig kennt, hat man natürlich gewisse Chancen. Aber man kann nicht überall und zu jeder Zeit irgendwo Jemanden kennen. Besser ist es natürlich, wenn man sozusagen eher gekannt wird, als selber zu kennen. Das bekommen aber nicht viele zustande, denn das sind Funktionärspositionen und die sind dafür etwas zu rar. Seit ich immer häufiger Leute erlebe, die sich kaum verhohlen im Vollgefühl ihrer Bedeutung als städtische Kulturprogrammplanungsbeauftragte, Club-Manager oder Festival-Organisatoren spreizen, erinnert mich die hiesige Entwicklung in der Tendenz - wie weiter oben bereits bemerkt - an die Umstände und Bedingungen, die vor der Wende in Ostblock- Staaten herrschten (Anmerkung/Zitat).
Ich bin zu diesem Thema, wie man wohl sehen kann, nicht gerade optimistisch eingestellt und frage mich, wann man wohl auf der Jazz-Szene etwas mehr Korruption einführen wird.
Im Pop-Bereich sehen berufliche Perspektiven sicherlich noch weniger vielversprechend aus. Die Meisten haben „Ochsentouren“ aus hart umkämpften Auftrittsgelegenheiten zu „Promo“-Zwecken vor sich. Es scheint äußerst begehrt zu sein, als Vorgruppe mit einer bekannten Band zu touren; dabei geht oft reichlich Geld über den Tisch - aber nicht für Musiker-Gagen. Man muß sich hier regelrecht „einkaufen“.
Korruption spielt allgemein (schon) eine bedeutendere Rolle als in der Jazz-Szene; das Prinzip „Pay To Play“ ist weitgehend etabliert und es scheinen nicht Viele zu sein, die hier andere Wege oder Perspektiven finden.
Jeder, der etwas Erfahrung und einen gewissen Überblick über die gesamte Materie usw. hat, kann hier zu keinem anderen Schluß kommen. Ich habe u. a. in meiner Region bereits allerhand Generationen von Jazz-Studenten vorbeidefilieren sehen, deren weitaus größerer Teil meist recht unmittelbar nach dem Studium in diversen Versenkungen verschwunden ist.
Irgendjemand (leider weiß ich nicht mehr, von wem das stammt) hat einmal die Stadt New York mit einem Ameisenhaufen verglichen, in dem jede Ameise bestrebt sei, ganz oben an der Spitze zu sein. Die Parabel scheint mir für alles mögliche Andere ebenso gut zu passen.
Ergänzen möchte ich, daß die Ameisen offenbar nicht recht wahrnehmen, daß nur einige wenige von ihnen für einen Aufenthalt an der Spitze in Frage kommen. Endgültig zu vergessen scheinen sie, daß alle genau dasselbe wollen - und, daß jede Einzelne glaubt, auch sie könne es schaffen.
Zu der gesamten Thematik kann ich persönlich zur Zeit leider kein positiveres Statement aufbringen.
* * *
Nach diesen Anmerkungen zur inflationierten Musik-Szene möchte ich noch einmal kurz zu „Musik-Historien“ zurückkommen.
Es war bereits die Rede von musikstilistischen Mischungen; im Hinblick auf Pop war ich bereits auf meine Wahrnehmung von „Adaptionen als Konzept des musikalischen Designs“ zu sprechen gekommen. Obgleich ich den Begriff „Musik Design“ aufgrund von Marketing-Strukturen, die ich im Pop-Business am weitesten entwickelt sehe, eben deshalb dort für passend halte, glaube ich nicht, daß sich das Integrieren von irgendwelchen stilistischen Einflüssen als Kriterium auf Pop beschränkt. Bekanntlich ist zum Beispiel Jazz ebenfalls aus eine Mixtur diverser Zutaten und Einflüsse entstanden. Alle Weiterentwicklungen beruhen ebenso darauf - und selbstverständlich auf der Kreativität jeweiliger Protagonisten.
Hierin sehe ich eine bedeutende Entwicklung in der Pop-Musik. Es gibt für meine Begriffe seit den späteren 1970er Jahren viel mehr interessante, kreative, ich würde auch sagen: inhaltlich reiche Pop-Musik. Vorsichtiger wäre ich allerdings darin, zu beurteilen, ob deren Anteil zugenommen hat; meine Beobachtungen lassen mich jedenfalls nicht erkennen, daß sich qualitative Anteile bzw. Anteiligkeiten in der Welt des Pop eklatant gewandelt hätten. Etwas deutlicher gesagt: bei dem immensen Ausstoß an Schrott ist der Anteil an gutem Zeug jedenfalls immer noch recht übersichtlich.
Hier drängt sich allerdings die weitergehende Frage auf, ob der genannte Anteil bei irgendeiner anderen Musikrichtung zum Beispiel höher wäre. Oder eben überhaupt irgendwie unterschiedlich. Ich möchte es als gedankliche Anregung einmal dahingestellt sein lassen.
Alles in Allem konnte sich Popmusik damit endgültig vom „Schlager-Image“entfernen - obwohl in der Masse an Trivialität und Kitsch das Meiste geblieben ist. Eindeutigen Zuwachs stelle ich im Pathos fest, das ich auch in der Entwicklung der Rockmusik bereits seit den späteren 1970er Jahren als ein bedeutendes Stil-Element empfinde. Ich gebe zu, daß ich allerdings gegen Pathos geradezu allergisch bin und daher möglicherweise dazu neigen könnte, solche Anteile hier und dort etwas überzubewerten.
Der Versuch einer halbwegs differenzierten Bestimmung, wie weitgehenden das Kriterium „Stil-Mischung“ darauf Einfluß gehabt haben könnte, ob mir bestimmte Musik gefiel (oder nicht), fällt mir nicht ganz leicht. Relativ klar ist mir, daß ich schlechte Adaptionen nicht leiden kann. Die fallen natürlich erst dann richtig auf, wenn man die Zutaten der Zeit „vor der Mischung“, also Originale kennt. Ich könnte beispielsweise erwähnen, daß ich „Funk“-Ingredienzen in Produktionen von Phil Collins nicht leiden kann (besonders das Zeug mit dem von „Earth, Wind & Fire“ gemieteten Bläsersatz). Es ist vollkommen unwichtig, daß es musikalisch-handwerklich gut ist. Es ist Mist und steht ihm (Collins) auch einfach nicht. Pseudo-Samba-Grooves von Bands wie z. B. den „Gypsy Kings“ lassen mir die Haare zu Berge stehen. Sehr viele Bossa-Nova-Adaptionen nordamerikanischer Jazzer der 60er bis etwa 80er Jahre finde ich entsetzlich. Darüber hinaus kann für mich auch die schiere Menge an (gleichzeitigen) Zutaten ein Kriterium sein. Genau das findet sich in minderwertigerer Pop-Musik besonders häufig. Wenn alles hineingekippt und miteinander verrührt wird, klingt es dadurch ja meist schon wieder einförmig - und auch trivial. Übrigens ist passenderweise genau dies - die amorphe, gleichzeitige Verwendung allzu vieler Stilmittel - eine der Haupt-Definitionen des Begriffes „Kitsch“ (Anm.: s. auch „Deutscher Kitsch“, Walter Killy, Verlag Vandenhoeck & Rupprecht, 1961). Es fehlt mir jedenfalls eine Art „geschmackliche Unterscheidbarkeit“. Worauf läuft das hinaus? Etwa auf die Spruchweisheit „Geschmack macht einsam“ - die mir unwillkürlich in den Sinn kommt? Muß man sich in Elitäres flüchten, um sich von dem ganzen billigen Schund, der krakeelend auf Einen einstürmt, in seinem Dasein nicht verletzt zu fühlen?
Der besagte, mit Beginn der 1980er Jahre einsetzende „Rückgang der Unterscheidbarkeit“ von Musikstilen ist also mit der zunehmenden Vielfalt an mehr oder weniger neuen Stilen entstanden, die aus den immer weiter betriebenen Mischungen der bisher entwickelten Mischungen herrührten. Er ist unter Wechselwirkung daraus entstanden, daß mit den Mixturen auch deren Beliebigkeit zunahm, die in manchen Fällen die stilistische Hauptaussage als Solche darstellt.
Hier könnte man dann als Misch-Ingredienz auch noch die zumindest in Deutschland kurzlebige, in den 70ern aus England und den USA übernommene, zu Beginn der 80er wieder vergangene „Folk-Bewegung“ erwähnen, die auch nach ihrem Ableben in immer umfassendere stilistische Ausbeutungen einbezogen wurde.
Auch in zeitgenössischem Jazz findet sich Einiges davon. Beispielsweise empfinde ich die Musik von Norah Jones definitiv nicht als Jazz, sondern eindeutig als „Country-Rock“ (also als stilistische Fusion von Rock mit „Country & Western“).
Nicht, daß ich die Musik nicht hin und wieder gern hören würde - es ist für meine Begriffe nur eben kein Jazz (ihr Plattenvertrag mit dem berühmten Label „Blue Note“ ändert daran auch nichts).
Es wurden zu all diesen „Cocktails“ jedenfalls fleißig neue Bezeichnungen erfunden - wenn mitunter klangliche Unterschiede nicht allzu konkret wahrnehmbar waren, so konnte man sie wenigstens nach der Bezeichnung unterscheiden. Der dem Schallplattengeschäft entstammende Ausdruck „Label“ kam in allgemeine Mode - es war ja spätestens in den 80ern immer essentieller geworden, seine Identität mit Produkten zu unterstreichen, die man konsumierte.
* * *
Mischungen waren ein besonders bedeutender „Hype“ der 80er - sie fielen wohl auch durch in der vorangegangenen Zeit insbesondere seitens der „Alternativ-Szene“ erarbeiteter betont pluralistischer Gesinnungen nun auch in weiteren Kreisen der Gesellschaft gewissermaßen auf fruchtbaren Boden.
Außerdem sollte immer möglichst „alles“ gleichzeitig zur Verfügung stehen - eine charakteristische Maxime einer Wohlstands-Gesellschaft (die das ganze Spektrum an Illusionen usw. gleich mit enthält). Ein Beispiel mit symbolischem Gehalt könnte wohl die in den 80ern entstandene Mode sein, bei Parties Obstsalate zu reichen, die ungeachtet der Jahreszeit eine immense Vielfalt von Früchten enthalten mußten - besonders hohe Beachtung fand die Gastgeberfamilie mit solchen „Kreationen“ natürlich in Winterzeiten: Brombeeren aus Israel, Mangos aus Brasilien, Erdbeeren aus Neuseeland und so weiter - alles in einem Topf (würg).
Allgemeine Tendenzen zum „Misch-Kult“ haben auch die Jazzer bemerkt, die dann plötzlich alle möglichen Musikstile auf ihre Fahnen bzw. Infos schrieben: „Bebop, Samba, Latin, Swing and more!“
Eine gewisse Mischmusik, die zu der Zeit durch Heranziehung von internationalen musikalischen Ressourcen hergestellt wurde, erhielt folgerichtig die Bezeichnung „World Music“ und eroberte schnell und weltweit die Bühnen der Jazz-Szene.
Es war natürlich von Vorteil, daß dieses Format auch in weiteren Kreisen Beachtung fand - um nicht zu sagen: auf größeren Märkten. Das Kreativitäts-Potential der dafür zuständigen Mixer äußerte sich allerdings durchaus unterschiedlich; mitunter geschah das globale bzw. globalistische „Heranziehen“ möglichst exotischer musikalischer Ingredienzien aus ziemlich durchsichtigen opportunistischen Motiven und unter schlecht verhohlener Attitüde kolonial-imperialistischer Manieren.
Es mußte eben irgendwie alles gemischt sein. Als eine typische Erscheinung der Zeit reüssierte die sogenannte „Multi-Kulti“-Bewegung - im Grunde gewissermaßen ebenfalls ein Erbe der Jugend-Bewegung der 60er und 70er, aufgekommen in Wechselwirkung mit der „Misch-Mode“ des aktuellen Zeitgeistes. Viel Bewegung brachte sie letztlich nicht zustande; irgendwelche programmatischen Inhalte waren in der Regel gut gemeint, größtenteils aber von politisch kurzsichtigem, recht naiven Wunschdenken beflügelt, scheiterten vielfach oder verliefen bald im Sande.
Dem „Denglisch“ - auch ein Mix; der Begriff selbst wurde erst ein wenig später erfunden - war Tür und Tor weit geöffnet: skurrile und teils krude Vokabelschöpfungen, deren Bedeutungen für anglophone Völker unverständlich sind, wurden insbesondere in Deutschland hemmungslos eingeführt. Dergleichen gab es zwar bereits früher, aber nicht in solchen Mengen - wie z. B. den berühmten „Slip“ (den es noch immer nur in Deutschland gibt). Da wir schon einmal bei diesem Thema sind: der „Slip“ wurde mittlerweile von der grotesken, um nicht zu sagen bescheuerten Wortschöpfung "Jazz-Pants" weit übertroffen, die es überdies als Sortenbezeichnung auch noch zum Fachwort gebracht hat. Ausgerechnet sowas! Ich hatte gehofft, dieses Unwort würde wieder verschwinden, aber dem scheint nicht so zu sein. Nun, die Rückbesinnung darauf, daß es wahrhaftig Wichtigeres gibt, hat an diesem Punkt der Betrachtungen vielleicht etwas Wohltuendes.
Auch ich fordere nicht, daß das Deutsche grundsätzlich von englischen Fremdwörtern freigehalten oder vor ihnen „geschützt“ werden soll. Vielmehr schließe ich mich dem Verein Deutsche Sprache an, der verlauten läßt: „... Das Deutsche ist wie viele andere Sprachen Europas eine Mischsprache. Der Wortschatz des Deutschen wird durch Wörter und Wendungen aus anderen Sprachen bereichert.“ Jedoch erläutert ein weiteres Zitat aus den “Sprachpolitischen Leitlinien“ des Vereins, was die Kritik u. a. beinhaltet: „ In den deutschsprachigen Ländern ist die Anglisierung und Amerikanisierung der Landessprache(n) besonders weit fortgeschritten.
Die Geringschätzung der Muttersprache, der Mangel an Sprachloyalität und die schwach ausgeprägte Förderung der deutschen Sprache von staatlicher Seite gefährden in diesen Ländern die Funktion der Sprache als Verständigungsmittel. Gleichzeitig (v)erklären Wissenschaftler, Meinungsführer und Politiker den Einfluss des Englischen zu einer begrüßenswerten Folge der Globalisierung. ...“.
Auch ich glaube, daß wir heutzutage in unserer Sprache ein hohes Maß an "unkritischer Anpassung an dieses pseudo-kosmopolitische Imponiergehabe" vorfinden.
Was flott sein will, scheint ohne „Englisch“ nicht auszukommen.
Der Radiosender SDR hat es zwar für nötig befunden, sich in der Konsequenz einer kostensparenden (profitmaximierenden) Fusion umzubenennen - auch dies eine entsprechende Zeiterscheinung, die um sich zu greifen begann - aber der Slogan vom „besten Mix“ ist noch immer genau derselbe (ist ja längst auch von anderen Sendern geklaut worden).
Und dieses ewige „... and more ...“ - ein typischer Slogan der 80er! Jedes kleine Einzelhandelsgeschäft hat sich solche Werbesprüche drangeklebt. Da war man umgeben von Reklame-Schöpfungen wie „Traveller Outlet Müller - Taschen, Koffer ... and more!“ Und, ja, und mehr.
Im Bestreben, dieses Thema nun nicht mehr weiter auszuarbeiten, will nur noch flüchtig auf Beispiele aus dem krampfhaft innovativem Sprachgebrauch der „Deutschen Bahn“ auf ihren Bahnhöfen mit „service points“ und „ticket counters“, die „db-lounges“ und „McCleans“ zu sprechen kommen.
Zurück zur Musik.
Besonders interessant finde ich die Bedeutung der etwa seit Beginn der 80er aufgekommenen Video-Clips. Es wurde nach kurzer Zeit obligatorisch, zu einem Pop-Song einen Clip zu produzieren. Die damit beginnende Verlagerung im Konsum von Musik von akustischer zu visueller Rezeption hatte so vielschichtige Auswirkungen, daß deren genauere Darstellung hier wiederum viel zu weit führen würde. Zum Verhältnis von Hören und Sehen soll hier immerhin Zweierlei angemerkt sein.
In der Psychologie gilt es seit langem als erwiesen, daß die rezipierende Konzentration auf akustische Vorgänge komplexer, schwieriger ist als visuelle. Nur zu hören ist also gewissermaßen anstrengender; bei simultanem Sehen und Hören steht die visuelle Rezeption im Vordergrund. Die Entwicklungen im Übergang vom Radio- zum Fernseh-Zeitalter kommen dabei in den Sinn und man wird in dem Rückschluß kaum fehlgehen, daß aufgezeichnete Musik ohne filmischen Anteil anders, sehr vermutlich vielfach etwas tiefgründiger wahrgenommen wurde. Ich glaube im Übrigen, daß Live-Musik mit (ton-)filmisch aufgezeichneter Musik vor dem Hintergrund dieser Aspekte nicht unbedingt verglichen werden kann. Lassen wir das zunächst einmal dahingestellt sein.
Ein Beispiel: mitten im Radio-Zeitalter der späten 1940er und frühen 50er Jahre wurde das kinderliedartige „Bye bye Blackbird“ zum zweiten Mal zu einem Welthit (1926 komponiert, war es zum ersten Mal ein Hit in den USA der späten zwanziger Jahre). Es ist gleichwohl melodisch durchaus nicht anspruchslos; viele Hörer hatten zudem die Struktur (AABA) so klar im Gefühl, daß sie z. B. auch ein Saxophon-Solo quasi nachvollziehen konnten - möglicherweise sogar ein Baß-Solo ;-) Ich muß hier einfach auf die Version auf "Youtube" mit der wunderbaren Julie London hinweisen - im Duo mit diesem großartigen Bassisten Don Bagley aus L. A. (Link). Natürlich kann bei solcher Musik der „Sinngehalt“ solch eines Solos erst richtig erfaßt werden, wenn man zum Rhythmus (Swing!) auch die Form des Songs nach- bzw. mitempfinden kann. In heutiger Zeit - zumal es in einiger zeitgenössischer Popmusik keine strophen-ähnlichen Formen gibt - weiß kaum noch Jemand, wo und warum irgendwas anfängt und aufhört. Erst recht nicht bei Musik, die aus unterschiedlichsten Gründen für Jazz gehalten wird, was insbesondere dann der Fall ist, wenn Rhythmus und Metrum nicht empfunden, mithin nicht verstanden werden. Wenn „Jazz“ gehört wird, obwohl man nicht weiß, wo ein Takt aufhört und wieder zu Ende ist, sind die Beweggründe für Jazz-Affinität oft diverse andere; nicht selten geht es darum, sich mit einer gewissen Attitüde zu versehen - gerade dies erlebe ich mitunter als recht eindeutig, zuweilen geradezu offensichtlich... Viele Leute glauben offenbar, daß wir ein Stück irgendwie anfangen und dann macht jeder eine Zeitlang, was er will und dann hört das Stück irgendwie auf - aber wie, das finden sie einfach nicht heraus. In der Tat werde ich manchmal von Leuten aus dem Publikum in Konzert-Pausen oder nach einem Konzert (auch fast wortwörtlich) gefragt, wie wir das als Band nur fertigbringen - daß wir immer gemeinsam aufhören.
Eine zweite Anmerkung sollte dieses Thema noch etwas anschaulicher erläutern. Frühere Video-Clips stellten die jeweiligen Sängerinnen und Sänger (mit zunehmender Häufigkeit auch ohne die begleitende Band) in hektischen Kamera-Einstellungen bei der Aufführung von Songs dar, was fast noch einen Charakter von „Konzert-Reportage“ hatte. Spätestens in den 90ern waren Video-Clips jedoch zu einer Art von Kurzfilmen mutiert, bei denen die tänzerische Performance bzw. eine zumindest angedeutete Mini-Story im Vordergrund stand, zu der die jeweiligen Songs lediglich die musikalische Untermalung bildeten. In jüngerer Zeit scheint sich die Videoclip-Performance eher zu einer Art „Posing“ zu wandeln (um nicht zu sagen: zu reduzieren), wie es bei „Photo-Shootings“ erforderlich bzw. zumindest üblich ist. Auch daran läßt sich, wie ich finde, beobachten, daß im Bereich des allgemeinen Musik-Konsums der Neigung „Sehen ist wichtiger als Hören“ Rechnung getragen wird.
Wenn man sich vielleicht noch quasi vor Augen hält, daß die Konzeption von vielen Live-Konzerten insbesondere der prominenteren Pop-Szene eigentlich mittlerweile ebenfalls eher auf visuelles Erleben ausgerichtet ist, wird der Blick auf das Zeitgeschehen vielleicht noch klarer. Ich neige zu der Ansicht, daß die Musik bei Live-Konzerten für das Publikum in Relation zu seinem „Gruppen-Erleben“, also einer Art von Gemeinsamkeitsgefühl bzw. der „Geborgenheit in der Masse“ und zum „Bühnenfeuerwerk“ (Pyrotechnik, Laser-Show etc.) tatsächlich nicht unbedingt die Hauptrolle spielt. Mir kommt es oft so vor, als spielten Bands ihre Musik nur noch als Untermalung zu ihrer Bühnenshow. Das empfinde ich als grotesk.
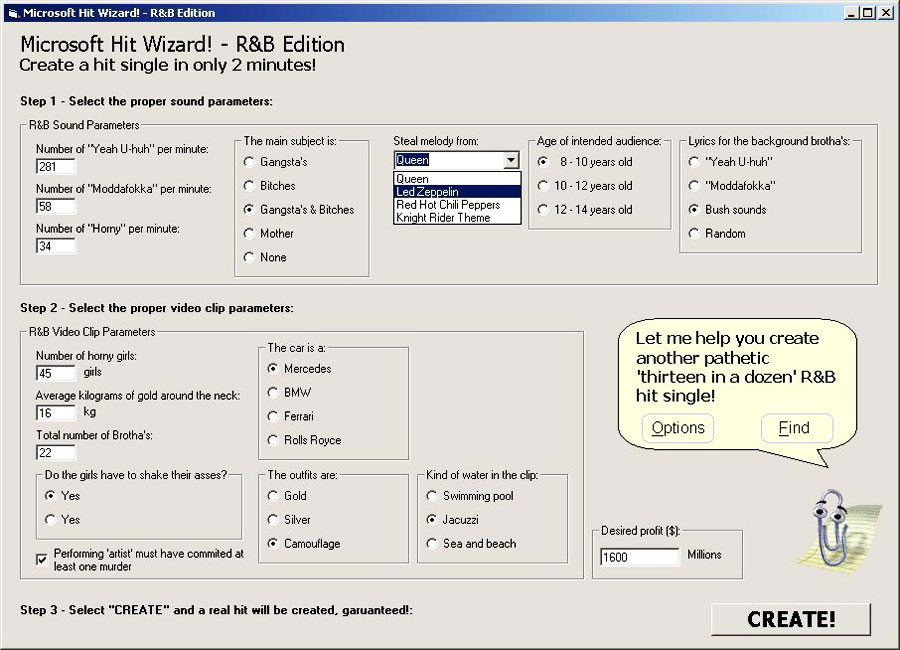
Diese Karikatur nimmt eine gewisse Abteilung von Pop-Musik und insbesondere die dazugehörigen Videoclips auf´s Korn. Der "Screenshot" einer (natürlich frei erfundenen) Programmoberfläche ging etwa um das Jahr 2000 herum per Mail rund um die Welt.
In den 1990er Jahren, die ja von der Weiterentwicklung einer inzwischen allgemein wahrgenommenen Profitmaximierungs-Hysterie geprägt waren, war die Ausbeutung der Mischungen aus bereits vorhandenen Substanzen als Konzept schon ziemlich abgenutzt. Die Beliebigkeit der Musik-Mixturen wurde durch die entwickelte Mentalität der hemmungslos gewordenen Selbstbedienung als Stil-Element (falls man es noch so nennen kann) immer vorherrschender. Mit dem Fortschritt des Internet wurden diverse totale Verfügbarkeiten zugleich bedeutender und normaler - insbesondere die von Musik. Es gab irgendwann kaum noch öffentliche Toiletten ohne Musik-Berieselung.
Konsum-Optionen wurden vereinfacht; mir kam es vor, als würde „Mühelosigkeit“ zu Motto und überragender Maxime. Alles mußte leicht fallen und keinesfalls mit Anstrengung verbunden sein - allerdings, wie ich weiter oben schon angemerkt habe, mit der großen Ausnahme der sportlichen Aktivitäten.
Dazu passend etablierte sich das offenbar aus dem Englischen rückübersetzte Stichwort „Spaß haben“ („to have fun“) quasi als Überschrift über alles Mögliche, insbesondere in Bezug auf Freizeitbeschäftigungen. Das kleine Wort „haben“ hat mich daran von Anfang an gestört.
Nach meinem Empfinden impliziert es eine naive, egozentrische, konsumistische Haltung, in der die eigenen Bedürfnisse eklatant im Vordergrund stehen und deren Befriedigung so rigoros von der Außenwelt verlangt wird, daß die Konsumorientierung mitunter geradezu kindlich-regressive Züge annimmt. So wird man zur leicht lenk- und manipulierbaren Beute von Werbung, setzt sich zunehmend Billig-Produkten aus und findet kaum noch Gefallen an qualitativ substantielleren Produkten bzw. höherwertiger Unterhaltung. Dazu scheint zu passen, daß so absurde „Lifestyle“-Begriff von „Spaß-Faktor“ über „Wellness“ bis „Trash-Kultur“ erfunden wurden - Letzterer übrigens ein Widerspruch in sich, bei dem es nach meiner Wahrnehmung um eine geradezu offensive Offenlegung der eigenen Bedürfnisstruktur geht, die folgerichtig in auf Instinkt-Programme reduziertes Verhalten und den Konsum auf rudimentärste Erscheinungsformen reduzierter Produkte mündet. Wenn man nach Feierabend um nichts in der Welt irgendwelche Anstrengungen in Kauf nehmen will, endet man offenbar bei dem, was angebotsmäßig „leicht und locker ´rüberkommt“ und den maximalen „Spaßfaktor“ hat. Auch Kindererziehung scheint zu den Themen zu gehören, für die man sich nicht mehr anstrengen möchte. So enden die Blagen dann ebenfalls vor den Bildschirmen. Darauf haben sich natürlich die Produzenten der Produkte für Fernsehkonsumenten eingestellt. Es scheint niemandem aufzufallen, daß insbesondere diverse Serienfilme kaum noch das Niveau der gern geschmähten sogenannten Groschenromane erreichen. Ich habe beispielsweise trotz mehrerer Versuche nicht verstehen können, wie es die Serie „Lindenstraße“ auch unter Leuten, die ich ansonsten ernst nehme, zu einem derart flächendeckenden „Kult“-Status bringen konnte. Banalität und Trivialität sind die kalorischen Hauptanteile dieser verblödungs-zementierenden geistigen Tagesrationen. Obendrein haben sie den Effekt einer mehr oder minder offensichtlichen „Verkindlichung“.
Gern würde ich näher darauf zu sprechen kommen - zum Beispiel über die erstaunlichen Entwicklung zur Kindlichkeit im Handschriftsbild von Erwachsenen (die nach meiner Ansicht längst nicht nur auf einen dem Computer geschuldeten Mangel an Übung zurückzuführen ist) - entscheide mich dennoch dafür, daß auch dieses Thema hier zu weit führen würde. Die allgemeine Infantilisierung in der bzw. durch die Medienlandschaft scheint mir jedenfalls schon sehr weit fortgeschritten zu sein.
Selbst für psychologische Hintergründe der abstrusen Nische des seit Jahren „boomenden Marktes“ für pädophile Erwachsene, die sich schließlich auf ein sich ausbreitendes Unvermögen von dem Lebensalter nach erwachsenen Menschen gründet, angemessene, erwachsene Beziehungen zu anderen Erwachsenen aufzunehmen, finden sich Erklärungen in der Infantilisierung der Gesellschaft durch die geistige Nahrung, der man sich mit den üblichen Massenprodukten der TV-Landschaft aussetzt.
Dazu scheint es mir passend, an die höchst erfolgreiche Serie mit dem vielsagenden Titel „Mini-Playback-Show“ als Beispiel zu erinnern.
 Beispiel-Photo zum Thema „Mini-Playback-Show“
Auch viele Kinder haben sich mit den grell geschminkten Lolitas und gel-frisierten Knäblein identifizieren können. Natürlich wurden auch die stolzgeschwellten, hirnlosen Erzeuger dieser zumeist eindeutig minderjährigen, komplett instrumentalisierten „Casting“-Objekte in den TV-Shows präsentiert - offenbar funktionierte die Identifikationsmöglichkeit für daheim mit ihren Kindern fernsehzuschauende, dabei in dumpfer Gedankenlosigkeit verharrenden Eltern ebenso gut.
Es gibt - so viel soll an dieser Stelle angemerkt sein - die sehr alte Fragestellung, ob eher die Produzenten oder die Konsumenten Erscheinungsformen und Standards der jeweiligen Produktpalette steuern. Auf die Medienlandschaft bezogen wurde spätestens im Zusammenhang mit dem sog. Erziehungsauftrag des Fernsehens (der seit Eröffnung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in deren Statuten steht) immer wieder diskutiert, ob Programminhalte eher dadurch gestaltet werden, daß Redakteure senden, was „das Volk“ will oder eher dadurch, daß das Gros der Bevölkerung sich trotz mancher Kritik und Nörgelei daran gewöhnt und letztlich damit abfindet, was Redakteure ihm vorsetzt. Ich persönlich bin von einer deutlichen Gewichtung in der Tendenz zu Letzterem überzeugt. Alle anderen Standpunkte halte ich für opportunistische Behauptungen - genau gesagt: für erstunken und erlogen. Obwohl ich ganz gut weiß, daß „die Dinge nicht ganz so einfach sind“, kritisiere ich damit vor allem den Umgang zumindest des staatlichen Fernsehens mit seinem pädagogischen und kulturellen Auftrag, dessen es sich offenbar weitgehend entledigt hat. Wenn man sich konsequent bewußt machen würde, was für eine reale Macht das Fernsehen über „das Volk“ hat und in der Tat ausübt, kann man, glaube ich, hier im Wesentlichen zu keinem anderen Schluß kommen.
Fernsehkonsum und Pop-Musik sind selbstverständlich zur Unterhaltung gedacht. Für meine Begriffe wurde die Unterhaltung im Verlauf der 1990er Jahre sukzessive noch weitergehender trivialisiert, besonders durch die neu hinzugekommenen „privaten“ TV-Sender.
Die Produkt-Werbung im Fernsehen spielte eine zunehmende Rolle. Ich erinnere daran, daß diese neuen TV-Sendeanstalten auf Druck und lobbyistische Interventionen der Industrie enstanden sind, um unbegrenzte Möglichkeiten zur Plazierung von Werbefernsehen zu schaffen. So weit ich weiß, war das Zeit-Kontingent für Werbung in den öffentlich-rechtlichen Sende-Anstalten nämlich auf tägliche zwanzig Minuten begrenzt.
Beides zusammen bildete das Konzept der neuen "privaten" TV-Sender: deutlich trivialere Unterhaltungssendungen und ein erhöhter Anteil an Werbefernsehen. So wird ein Volk lenkbarer gemacht. Ein, wie man wohl konstatieren kann, recht stabiles Konzept...
Die bereits erwähnte Ansicht, daß sich spätestens in dieser Zeit innerhalb der TV-Medienlandschaft eine flächendeckende Infantilisierung (Verkindlichung) abspielte, erstreckte sich bald und ganz besonders auf die Gestaltung von Computerspielen, die als Freizeitbeschäftigung eine immer größere Rolle zu spielen begannen. Die Welle von „Fantasy“-Filmen spricht ebenfalls für sich. Man empfindet sich mittlerweile als zu einer Minderheit gehörig, wenn man zugibt, an derlei opulenten Phantastereien wenig Gefallen zu finden, die meist irgendeiner Vergangenheit alle möglichen Fiktionen andichten, manchmal noch mit ominösen Heilslehren verknüpft sind und insgesamt vielfach trivialste Klischees enthalten. Die immer spektakuläreren optische Effekte der Machwerke stehen in zunehmendem Widerspruch zu ihren immer alberneren und infantileren Inhalten. Mit technologischem Fortschritt wurden Filme äußerst virtuos zu Computer-Spielen umgesetzt - oder auch umgekehrt. Bei weiterer Stilisierung der Spiele zu Kitsch und Albernheit kam sehr bald eine schier unglaubliche, in ihrer Bildhaftigkeit und optischen Darstellung immer realistischere Blutrünstigkeit hinzu - mit bekannten Folgen; um einige benennen, könnte man z. B. damit beginnen, gewisse Städtenamen aufzuzählen. Die Verbreitung von Computerspielen bekam einen derartigen Aufschwung, daß „Spielen“ innerhalb kurzer Zeit überall zu einem Thema wurde und z. B. für erwachsene Leute als intensive Betätigung merkwürdig normal und salonfähig geworden ist (Kleine Anmerkung).
Dies geht über den an und für sich „normalen“ Spieltrieb erwachsener Menschen, der seinen Ausdruck in Karten- oder anderen Gesellschaftsspielen hat, weit hinaus.
Der Eindruck, daß mit TV-Konsum und PC-Spielen eine Realitätsflucht betrieben würde, konnte sich für den kritischen Betrachter immer stärker verdichten. In einer seltsamen, sozusagen halb-offensichtlichen Weise schien sich die infantil-egozentrische Neigung zu pseudo-realistischen Spielereien noch auf einige andere Bereiche zu erstrecken - insbesondere auf Gewinnspiele in der Form von Finanzspekulationen an Börsen.
Die lange bekannte klinisch-psychologische Problematik der Spielsucht entwickelte ihre Symptome in der globalen Finanz- und Wirtschafts-Szene geradezu flächendeckend. Dieser Aspekt wurde allerdings selten offen angesprochen und noch seltener konsequent formuliert. Man verglich Börsen zwar auch in der Klatsch-Presse mit Casinos, aber zu einem Teil einer Erklärung für sich entwickelnde weltweite Wirtschaftskrisen und der logischerweise dazugehörigen Empfehlung von Therapien für deren Verursacher kann man sich bis heute nicht durchringen. Empfehlungen würden dabei allerdings auch wenig bewirken. Und zu Verordnungen bräuchte es ja wohl Maßnahmen, die demokratische Befugnisse zumindest stark belasten, wenn nicht überfordern. Ich glaube jedenfalls, daß man einige Klarheiten in der Ursachenforschung krisenhafter ökonomischer Entwicklungen bekommen kann, wenn man sich einmal etwas näher mit der Symptomatik von Spielsucht befaßt.
Jedenfalls spitzte sich das Klima an Börsen, auf fast allen Absatzmärkten und auch an sehr vielen Arbeitsplätzen zu. Die allgemeine gesellschaftliche Stimmung wurde aggressiver.
Bei Großunternehmern bis hin zu einfachen Sparkassendirektoren zeigten sich in der Art der Unternehmensführung deutliche Neigungen zu Abenteurertum, das sich nicht nur in Finanzspekulationen ausdrückte und in der Konsequenz altbekannte Züge von Kolonialismus sowie dem sonstigen Dünkel eines neureichen Geldadels hinzunahmen. Sogar immer mehr kleine Privatleute „spielten“ an der Börse - zum Teil mit extra dafür aufgenommenen Bankkrediten. Börsenberichte gehörten plötzlich zum Nachrichtenprogramm in Radio und TV. Begriffe wie Gewinn-Marge und Rendite bekamen eine Art religiösen Beiklang und jedenfalls zunehmende Priorität mit sich vergrößerndem Abstand vor allem Anderen. Man lernte eine neue Bedeutung des Wortes „Heuschrecke“ kennen. Das allgemeine Klima an Arbeitsplätzen verfinsterte sich allmählich ziemlich flächendeckend.
Das kann die folgende Geschichte ein wenig illustrieren: eine Bekannte kehrte nach über zehnjähriger Pause wieder in ihren erlernten Beruf als Rechtsanwalts-Assistentin zurück. Sie war nach kurzer Zeit ziemlich frustriert über das inzwischen etablierte hohe Arbeitstempo - „man muß jetzt die Arbeit von mehreren Personen bewältigen“ - außerdem habe vordem ein „persönlicheres“, netteres Betriebsklima geherrscht. Das klingt, als habe sich diese Geschichte erst neulich ereignet, oder? Sie datiert von 1986. Garnicht mal so lustig, nicht wahr? Die Entwicklungen gehen, wie man sieht auf eine längere Vorgeschichte zurück. Ein Unterschied zu heute besteht höchstwahrscheinlich darin, daß es leichter gewesen sein dürfte, nach der langen „beruflichen Aus-Zeit“ und in entsprechendem Lebensalter so einen Arbeitsplatz überhaupt noch einmal wiederzubekommen.
Eine Zeiterscheinung auf dem Arbeitsmarkt, die man in diesem Bezug als „Jugend-Wahn“ bezeichnete, hat nach meiner Wahrnehmung im ersten Drittel der 90er Jahre um sich gegriffen. Es entstand vielfach der Eindruck, daß junge Leute von Unternehmen und Betrieben engagiert wurden, um „auf Deubel komm raus“ irgendwelche innovative Wirkungen zu erreichen. Die Wertschätzung gegenüber erfahreneren Kräften sank in dieser Zeit mit erstaunlicher Plötzlichkeit. Man diskutierte in Politik und Gesellschaft die Phänomene von ziemlich flächendeckenden Entlassungen älterer Mitarbeiter (zugunsten der Neu-Einstellung jüngerer Kräfte). Der zunächst neue Begriff „Langzeitarbeitslosigkeit“ fand allmählich Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch.
Ich habe als Gast bei einer extra zum Zweck einer Art „Kontakt-Börse“ veranstalteten Universitäts-Party in Mannheim erlebt, wie angehende Betriebswirtschaftler mitten im Studium mit Job-Angeboten (insbesondere für Management-Positionen) aus der Wirtschaft umworben wurden. Solche Parties der entsprechenden Fakultäten waren als Job-Börse konzipiert, zu der man entsprechende Vertreter aus Industrie und Wirtschaft gezielt einlud. Nicht wenige Studenten verließen sich auf die Versprechungen, die man ihnen machte. Sie brachen ihr Studium ab, um sich dann schlimmstenfalls gleich nach einer der ersten (ebenfalls durch Spekulation verursachten) Krisen der 90er („IT-Blase“ etc.) zwischen allen Stühlen wiederzufinden - ein paar Jahre älter sowie ohne Job und eben auch ohne abgeschlossene Ausbildung. Für ältere Menschen dagegen wurde es immer schwieriger, berufliche Perspektiven zu erhalten - ganz besonders nach einem Arbeitsplatzwechsel bzw. einer Kündigung.
Ähnliches galt im Prinzip und parallel natürlich auch für die Musik- bzw. Musiker-Szene. Der entsprechende Wettbewerbsdruck wurde intensiver; für Produkte, deren Image eben „jung“ sein sollte, können ja schließlich nur junge Leute stehen. Jugendlichkeit wurde in Marketing-Strategien zu allgemeiner „Kultigkeit“ erhoben. Image-Kampagnen fügten diverse Eigenschaften unter dem Sammelbegriff „dynamisch“ hinzu und verknüpften natürlich die Begriffe „jung“ mit „modern“.
Eben darüber, fürchte ich, kann man jedoch recht unterschiedlicher Auffassung sein.
Die assoziative Verknüpfung von „jung“ und „modern“ als personale Eigenschaften hat zwar eine lange Tradition, ich sehe sie allerdings seit etwa gut zwei Dekaden nicht mehr in unbedingter Stringenz und Schlüssigkeit. Es gibt für meine Begriffe seit den späten 1970er Jahren in offenbar recht weiten Kreisen jüngerer Generationen einen tendenziell zunehmenden Konservativismus, der mich zuweilen erstaunt. Vielleicht liegt das daran, daß nach meiner Wahrnehmung gewissen Modeerscheinungen und anderen Zeitströmungen zumindest temporär viel bereitwilliger gefolgt wird, als ich das von mir selbst in Erinnerung habe.
Sogar in einer Markt-Nische wie der Jazz-Szene wurde es ökonomisch riskanter, sein jugendliches Alter mit fortschreitender Zeit hinter sich zu lassen. Mich persönlich betraf das zufällig auch. Die Jazz-Szene meiner Altersgruppe ist zwar recht überschaubar, denn schließlich war Jazz in der Zeit, als Ende der 50er Jahre zur Welt gekommene Kandidaten so etwa fünfzehn bis zwanzig Jahre alt waren, unter Gleichaltrigen äußerst wenig gefragt - zu meinem Leidwesen insbesondere bei den Mädels - aber ich hatte den in meiner Altersgruppe relativ typischen späteren Marsch in Institutionen
wie „Hochschul-Job“ oder „Rundfunk-Bigband“ o. ä. nicht angetreten. Jedenfalls fiel mir zur Problematik des Alterns in einem freischaffenden Beruf zu Zeiten eines aufkommenden allgemeinen „Jugend-Kultes“ ein Statement wie etwa dieses ein: „ Bis höchstens Dreißig Jungtalent, vielleicht ab Siebzig Legende. Dazwischen kannst Du zusehen, wo Du bleibst“.
* * *
„Kult“ kam als Produkt-Attribut ungefähr mit Beginn der 90er auf; ich glaube, es bedeutet, über die Bereitstellung und Propagierung einer Art ethischen und kulturellen Orientierung eine quasi-religiöse Hinwendung der kaufenden Massen zu einem Produkt zu erwirken, dessen substantieller Inhalt bzw. Wert allerdings zweitrangig ist. Das alte Wort „Kult“ hat einen Bedeutungswandel mit stark demagogischem Akzent erfahren - es ist seit den 1990ern, wie ich finde, die Mogelpackung an, für und in sich.
Zumindest die Produktionskosten standen (als Faktor der Profitmaximierungs-Zielsetzungen) bei dieser Neuauflage des „Kult“-Begriffes mit solchem Abstand im Vordergrund der Kalkulation, daß gegen Ende der 90er Jahre wieder nach einer „Wirtschafts-Ethik“ gefragt wurde.
Es hat noch fast eine weitere Dekade gedauert, bis sich die Diskussion darüber ausbreitete und führende Köpfe der Gesellschaft deutliche Formulierungen fanden. Als ein Beispiel sei hier Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt genannt, der das Wort vom „Raubtier-Kapitalismus“ prägte (Anm.: in diesem Zusammenhang sei die Lektüre seines Buches „Außer Dienst“/Siedler Verlag 2008 empfohlen).
Mit zunehmendem Fortschritt elektronischer Medien erhöht sich die Geschwindigkeit, mit der Konsumenten alle möglichen Angebote zugeführt werden. Die Entwicklung ist bereits so lang im Gange, daß es einer Binsenweisheit gleichkommt, mal wieder zu konstatieren „alles wird schneller“. Die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung der Rezipienten wird dadurch natürlich jedenfalls oberflächlicher. Es braucht also Ideen, um Produkten eindeutigere Marken-Profile zu verschaffen. Dazu war die „Kult“-Strategie vorzüglich geeignet. In der gesamten Kunst-Szene und besonders im Pop-Business wurde sie besonders häufig verwendet - und damit also diversen inhaltlich halbwegs substantiellen Erzeugnissen ein weniger künstlerischer als vielmehr ziemlich künstlicher „Kult-Status“ angedichtet.
Das Hauptgeschäft machen meist mehr oder minder begabte Epigonen, die sich sofort auf alles stürzen, was es - über subkulturelle Legendenbildung oder Werbung oder beides - gerade eben halbwegs zu „Kult-Status“ gebracht hat. Man denke z. B. an die New Yorker Rapper von „Main Source“, auf die sich scharenweise andere Rapper beziehen (der Band-Titel „Main Source“ könnte möglicherweise symbolisch dafür stehen - oder sollte er es vielleicht?). Das zu beklagen ist allerdings recht sinnlos. Das Syndrom ist, wie man so schön sagt, systemimmanent. Jedenfalls - und um einen positiven Aspekt dagegenzuhalten - gibt es hierzulande und in manchen anderen Ländern immerhin die Tradition und kulturelle Errungenschaft, im Prinzip nicht daran gehindert zu sein, sich um Originalität zu bemühen. Das ist schon viel. Eine andere Frage ist, wie man damit einen Lebensunterhalt bestreitet.
Im Wirtschaftsbereich erweisen sich insbesondere chinesische Unternehmen als zunehmend erfolgreich. Mit ihrer - wie gesagt wird: angeborenen - Emsigkeit schaffen sie es, den Markt insbesondere mit preisgünstigen Plagiaten zu überschwemmen, deren Stückkosten praktisch konkurrenzlos sind. In einer Haltung, die sich aus der Mischung konfuzianischer Traditionen und (lange unterdrücktem) kapitalistischen Wettbewerbssinn zu erklären scheint, wird es meist als Kompliment an einen Produzenten, als eine Art „Hommage“ bezeichnet, dessen Produkte nachzubauen. Es ist dem typisch chinesischen, in Lächeln und Ernsthaftigkeit jeweils gleichermaßen undurchdringlichem Gesichtsausdruck allerdings nicht abzulesen, inwieweit das wirklich ernst gemeint ist. Mittlerweile mausern sich chinesische Produkte - allen westlichen Unkenrufen (=Schutzbehauptungen) zum Trotz - auch in puncto Kreativität und Qualität. Es ist meiner Überzeugung nach absehbar, daß das chinesische „staatskapitalistische“ Wirtschaftssystem erfolgreicher sein wird, als das noch immer praktisch unreglementierte „marktkapitalistische“ des „weißen Westens“. Von der eigentlich weltweiten Wirtschaftskrise ab 2008 ist die chinesische Wirtschaft wenig betroffen gewesen. Den Geist westlicher „neoliberaler“ Hasardeure wird man dort vergeblich suchen. Einige Staaten sind von China, das sich anschickt, Deutschland als „Exportweltmeister“ abzulösen, wirtschaftlich bereits faktisch abhängig - wie nicht zuletzt auch die USA.
Man sollte das im Selbstbewußtsein der chinesischen Bevölkerung seit Jahrtausenden verankerte und durchaus nach wie vor aktuelle - wenn auch selten offen geäußerte - Überlegenheitsgefühl über alle anderen Kulturen dieser Welt - Scholl-Latour nennt es „Superioritäts-Komplex“ - nicht außer Acht lassen.
Zurück zur Musik: es dürfte nicht übertrieben sein, festzustellen, daß den verbliebenen kreativen Kräften der jeweiligen Szenerien die wenigen neuen Ideen spontan aus der Hand gerissen werden, kaum daß Entwicklungszeit eingeräumt wird, um sie unverzüglich zu vermarkten. Pete Townshend („The Who“) beklagte sich bereits den 70ern in einem Interview darüber, daß ihm für die Entwicklung eines Songs immer weniger Zeit gelassen würde. Andauernd stünden Typen von der Plattenfirma vor der Tür usw. Bekanntlich hat sich das „Marketing-Tempo“ seither enorm erhöht. Vielfach können Ansätze zu Innovationen so nur unvollständig entwickelt werden.
Man könnte unter diesem Gesichtspunkt über eine vieldiskutierte, nach meiner Wahrnehmung jedoch nur scheinbare „Verlangsamung des Innovationstempos“ im Jazz der letzten Jahre und Jahrzehnte ins Nachdenken kommen. Ich glaube, es ist sogar ein bißchen was dran an dem Gedanken. Aber ich würde große Vorsicht empfehlen, denn meiner Meinung nach liegt hier weder ein wirkliches Problem vor, noch die gesamte Erklärung dafür. Ohne Zweifel entwickelt sich Jazz kontinuierlich. Die Entwicklung nimmt unvorhergesehene Wege - unter anderem indem Errungenschaften früherer Jahre immer dezidierter mit solchen der heutigen Zeit verbunden, verknüpft und sonstwie verarbeitet werden. Das braucht Zeit - mehr, als man sich in vielen anderen Bereichen zugesteht. Daher habe ich die besagte „Verlangsamung“ als scheinbar bezeichnet. Man könnte nun auch dieses Thema wesentlich ausführlicher behandeln, aber es würde wieder einmal zu weit führen.
Im Hinblick auf den sich immer zügiger vergrößernden Bedarf an Neuigkeiten ist es fast schon erstaunlich, wie viele Produktionen im Kulturbereich ein nennenswertes bis mitunter vorzügliches Niveau aufweisen. Ich wollte damit allerdings nicht behaupten, es seien tatsächlich sehr Viele.
Da wir auf eine bereits recht lange Zeit zurückblicken, in der technische Neuerungen etc. erfolgreicher entwickelt werden konnten als kulturelle Innovationen, glaube ich, daß sich eine Art äußerlicher Innovations-Druck von der Industrie- auf die Kultur-Szene übertragen hat. „Innovation“ an und für sich wurde ja längst zum Kult erhoben. In der Mogelpackung steckte allerdings sehr Vieles, das wohl zutreffender mit „Innovation um der Innovation willen“ beschrieben werden kann. Gemeint ist jedenfalls etwas, das sich mit diversen eher oberflächlichen, meist äußerlichen Überarbeitungen einen recht zweifelhaften Anstrich von Modernität gibt.
 Opel Olympia P1 Kombi von 1957
Im Bereich von Technik und Naturwissenschaft kann eventuellen Gefahren mangelnder oder ausbleibender Innovationen teilweise dadurch begegnet werden, daß die Anzahl der an Forschung und Entwicklung arbeitenden Menschen und die Etats dafür hoch genug, jedenfalls unvergleichbar höher liegen als im Kulturbereich.
Ich schätze, es hat sich mittlerweile allgemein herumgesprochen, daß in Politik und Wirtschaft beim Stichwort „Sparmaßnahmen“ reflexhaft als erstes an den Kulturbereich gedacht wird - als hätten solche Versuche schon irgendeinmal einen nennenswert positiven Effekt auf die Haushaltskonsolidierung auch nur der kleinsten Gemeinde gehabt. Es soll beiläufig daran erinnert sein, daß der Kultur-Etat der aktuellen Regierung gerade einmal 1,6% des Gesamthaushaltes beträgt - was zum Teufel sollen Sparmaßnahmen hier bewirken? Irgendwelche Effekte bestehen viel eher darin, daß sehr bald spürbar weniger „Leben in der Stadt“ ist. Man möchte natürlich, daß „was los ist“, aber es darf halt nix kosten. Mir will außerdem immer scheinen, daß die bereitwilligen Attacken auf Kultur-Etats auch dazu dienen sollen, ein fleißiges Bemühen, eine Geschäftigkeit vorzutäuschen - „wir müssen etwas tun und wir tun auch was“. Dieser Blödsinn zeugt insbesondere davon, daß größere Zusammenhänge in der Wirtschaftspolitik weder verstanden noch (andernfalls) berücksichtigt werden. Wir würden aber Persönlichkeiten dringend brauchen, die das dazu benötigte Wissen und die Courage besitzen, denn gerade in der Wirtschaftspolitik sind einige langfristig angelegte und auch unpopuläre Maßnahmen immer dringender erforderlich. Meist wird jedoch lediglich im Hinblick auf parteipolitische Erfolge taktiert und nicht über die aktuelle Legislaturperiode bzw. die nächsten Wahlen hinaus gedacht. Infolge unpopulärer Entscheidungen wären ja auch Wählerstimmenverluste zu befürchten.
So muß man obendrein zu dem Schluß kommen, daß, wenn wir überhaupt mal wieder seriös agierende Wirtschaftspolitiker hätten, wir dieselben umgehend abwählen würden.
Expansionistisch-imperialistische Ambitionen der „Wirtschafts-Szene“ der 90er expandierten ungehemmt - wie die selbstverständlich damit verbundene Haltung, sich Angestellte und Politiker möglichst weitgehend untertan zu machen und in der Konsequenz überall das Äußerste herauszupressen. Diese Ambitionen haben das gesellschaftliche Klima stark geprägt - die Verfolgung der eigenen Interessen hat immer höheren Vorrang vor irgendeiner Art von Gemeinwesen bekommen (Helmut Schmidt bezeichnet dies unter Zitat von Seneca als „salus publica“). Nicht etwa nur hierzulande ist der genannte Vorrang weit entwickelt: gerade zur Zeit werden diesbezüglich extrem fortgeschrittene Zustände in Griechenland publik.
Da mir neulich ein recht zeitloses Gedicht von Erich Kästner auffiel, das mir in diesen Zusammenhang zu passen scheint, möchte ich es auch zitieren. Es ist ein Weihnachtsgedicht und erschien erstmal in der Zeitschrift „Weltbühne“ im Jahr 1930:
„Lieber, guter Weihnachtsmann,
weißt du nicht, wie's um uns steht?
Schau dir mal den Globus an.
Da hat einer dran gedreht.
Alle stehn herum und klagen.
Alle blicken traurig drein.
Wer es war, ist schwer zu sagen.
keiner will's gewesen sein.
Uns ist gar nicht wohl zumute.
Kommen sollst du, aber bloß
mit dem Stock und mit der Rute.
(Und nimm beide ziemlich groß.)
Breite deine goldenen Flügel
aus, und komm zu uns herab.
Dann verteile deine Prügel.
Aber bitte nicht zu knapp.
Lege die Industriellen
kurz entschlossen übers Knie.
Und wenn sie sich harmlos stellen,
glaube mir, so lügen sie.
Ziehe denen, die regieren,
bitteschön, die Hosen stramm.
Wenn sie heulen und sich zieren,
zeige ihnen ihr Programm.
Komm, und zeige dich erbötig,
und verhau sie, dass es raucht!
Denn sie haben's bitter nötig.
Und sie hätten's längst gebraucht.
Komm, erlös uns von der Plage,
weil ein Mensch das gar nicht kann.
Ach, das wären Feiertage,
lieber, guter Weihnachtsmann!“
Nun, irgendwie zeitlose Poesie, nicht wahr?
Im Wirtschaftssystem damals wie heute gab es und gibt es nicht genügend Regularien, um ungebremsten Profitmaximierungs-Intentionen Einhalt zu gebieten, die zum Beispiel die Einkommenslage der einzelnen Bevölkerungsschichten allzu weit voneinander entfernen. So lange es dergleichen nicht gibt, werden „die Industriellen“ es für völlig rational und somit normal halten, ihre Möglichkeiten schlicht und einfach zu nutzen. Appelle an Moral und „Wirtschaftsethik“ werden kaum greifen und nach wie vor heuchlerischen bzw. naiven politischen Sonntagsreden vorbehalten bleiben.
Man könnte interpretieren, daß Kästner hier mit dem Appell „... zeige ihnen ihr Programm“ an den Weihnachtsmann im Grunde einen „starken Staat in einer sozialen Marktwirtschaft“ postuliert, wie es auch Helmut Schmidt fast achtzig Jahre später in prinzipiell gleicher inhaltlicher Richtung tut (in seinem besagten Buch „Außer Dienst“).
Die Entwicklung von in den 80ern noch relativ offen ausgelebtem bzw. öffentlich gezeigtem Wohlstand zu eher diskreteren, verdeckteren Formen des privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Agierens in den 90ern ist natürlich ebenfalls eine Auswirkung der erwähnten um sich greifenden Betätigungen in Industrie sowie privaten, teils sogar staatlichen Instituten insbesondere auf dem Feld von Finanz-Spekulationen.
Nebenbei sei daran erinnert, daß die Wortschöpfung „notleidende Banken“ zum „Unwort des Jahres“ 2008 gewählt wurde. Übrigens bin ich in 2009 einmal so weit gegangen, der zuständigen Kommission nach der Lektüre eines „Spiegel“-Artikels mit der Überschrift „Die Hungerrentner von morgen“ das dort verwendete Wort „Selbstverwirklicher“ vorzuschlagen, das ich aus Gründen, die ich wohl nicht erklären muß, für saumäßig zynisch hielt. Es wurde im Zusammenhang mit Personen verwendet, deren Lebensplanungen in unzureichende Rentenerwartungen münden. Ich habe meine Meinung dazu nicht geändert, war aber sehr damit einverstanden, daß schließlich das unglaubliche Adjektiv „betriebsratsverseucht“ gewählt wurde (man beginne einen Satz mit: „das Unternehmen ist ...“).
In gesellschaftlichen Kreisen mit hohen Rentenerwartungen hielt man sich jedenfalls allgemein bedeckter, repräsentative Veranstaltungen kamen aus der Mode, Reichtum öffentlich zu zeigen kam fast schon in Verruf. Status-Manifestierung, vulgo Protzerei, ist natürlich nicht etwa passé - man bleibt aber auch mit diesem Bedürfnis eher „unter sich“. Es wird - ich sehe darin eine Art „diffus prophylaktische“ Verteidigungshaltung - eine deutlichere Klassentrennung lanciert, die über kurz oder lang noch prägenderen Einfluß auf den sogenannten Zeitgeist, mithin die gesellschaftlichen Verhältnisse gewinnen wird. Das Ganze wird wohl auch nicht mehr lange diffus bleiben. Ein Wandel von besagter Verteidigung zu eher kämpferischen Haltungen zeichnet sich bereits ab. Das Wort vom „Klassenkampf von Oben“ ist längst nicht mehr neu. In sozio-ökonomischen Perioden, in denen Unternehmensgewinne und Arbeitslosigkeit gleichzeitig steigen, müssen sich Themen wie Wirtschaftsethik - die schließlich so ziemlich sämtliche Aspekte der sozialen Marktwirtschaft enthält - per definitionem in der Kategorie der sogenannten „weichen Werte“ wiederfinden. Kultur gehörte dann sowieso schon längst da hin. Es sei denn, man könnte sich als Sponsor profilieren. Dann wäre es vielleicht doch noch was für die Öffentlichkeit, d. h. für´s (eigene) „Label“. Oder sie wäre „richtig“ teuer. Dann ist es aber mehr was für´s Wohnzimmer.
In den 1990ern und der nachfolgenden Dekade wurde seitens der Politik aus falsch verstandenen und verkehrten Ideologien, Klientelpolitik und mangelndem ökonomischen Sachverstand noch erheblich mehr an Deregulierung der Wirtschaft zugelassen. Praktisch die gesamte Finanzwirtschaft hat bei gleichzeitigem Wissen darum, daß es zur Krise kommen würde, noch so lange wie es eben ging weitergemacht (passender alter Witz: „nach mir die Stinkwut“).
Die Krise, die ja, wie Helmut Schmidt in seinem bereits erwähnten Buch eindrucksvoll darlegt, im Ansatz eigentlich schon in den 70ern zu erkennen war, kam nicht zuletzt durch Liberalisierungsmaßnahmen ausgerechnet der Sozialdemokraten (unter der Schröder-Regierung) in den „Nuller“ Jahren endgültig zustande. Diese Periode war ja von einer geradezu endzeitlichen Profitmaximierungs-Hysterie geprägt; die Pervertierung z. B. von „Private Equity-“ und „Hedge“-Fonds zu Glückspiel-Wetten - meist mit dem Kapital mehr oder weniger ahnungsloser Außenstehender - uferte vollends aus usw. Mittlerweile können komplette nationale Volkswirtschaften von der Börse aus attackiert werden, wobei es möglich und verbreitet ist, auf deren „Staatsbankrott“ bzw. dagegen zu wetten (z. Zt. sind Griechenland, Portugal und Spanien betroffen). Man stelle sich vor, daß riesige Summen an Banken und Privatpersonen etc. ausbezahlt werden, wenn der Fall eines griechischen Staatsbankrottes tatsächlich eintreten sollte. Das ist ebenso sinnlos wie unerträglich.
Nach wie vor tun erklärte Haupt-Verursacher der Krise alles dafür, weiter so wie bisher zu verfahren - Parallelen zu Spielsucht im klinisch-psychologischen Sinn werden immer eklatanter. Gestaltung und Durchsetzung von Spielregeln und Spielfeldbegrenzungen haben insbesondere eine Aufgabe der Politik zu sein - wo sie unzureichend sind, muß etwas geschehen. Selbstverständlich halte auch ich Banken grundsätzlich für sinnvoll und notwendig, aber viel zu viele insbesondere junge Finanz-Manager haben den Bezug zur Realität und zu einem Gemeinwesen weitestgehend verloren. Leider ist unsere momentane Regierung zögerlich und ineffizient. Ich glaube, daß die Krise noch längst nicht überwunden ist.
Ich wüßte zwar im Augenblick nicht, wem man wirklich vorwerfen könnte, statt neo-liberale Deregulierungsmaßnahmen einzubringen, nicht vorausschauend und rechtzeitig genug Regulierungsmaßnahmen gegen überbordenden „Raubtier- und Kasino-Kapitalismus“ in unser System eingebaut zu haben, aber es ist inzwischen wohl klar genug, daß dieses System, also das kapitalistische Wirtschaftssystem des sogenannten westlichen Kulturkreises ohne solche Gesetze zum Scheitern verurteilt ist. Ob die Alternative in die Richtung eines „Staatskapitalismus“ geht, wie er sich seit Deng Xiaoping in China entwickelt, würde ich bezweifeln und mir aus diversen Gründen auch absolut nicht wünschen. Um das Thema hier einmal abzuschließen, möchte ich - ähnlich der vorangegangenen Interpretation von Kästners „Weihnachtsgedicht“ - anmerken, daß es nur ein Aspekt ist, auf fehlende Moral und mangelnde Wirtschaftsethik z. B. „der Industriellen“ als Gründe für die gesellschaftlichen Mißstände hinzuweisen. Ich denke, daß man sich kaum darüber wundern kann, daß irrwitzige, amoralische Finanz-Spekulationen, „Bonus“-Zahlungen und dergleichen mehr weiterhin durchgeführt werden, solange es keine geeigneten Gegenmaßnahmen des Staates gibt, weil es für rational gehalten wird, zu tun, was das System erlaubt bzw. nicht verhindern kann. Man wäre doch schön blöd, wenn man den Haufen Geld, der herumliegt, nicht mitnimmt. Was hätte man denn von der ganzen Moral, wenn man die Kohle liegenläßt? Wahrscheinlich würde sie stattdessen irgendein nächstbester Anderer einkassieren. Also nimmt man, was man kriegen kann und fertig. Jemand, dem die gesamte Produktionskette von der Pumpe an der Ölquelle bis zum Zapfhahn an der Tankstelle gehört, kann leicht die Benzinpreise erhöhen.
Natürlich führt das zu einer subjektiv-persönlichen mehr oder weniger schleichenden moralischen Degeneration und ganz nebenbei zu einem, wie ich glaube, Niedergang der allgemeinen „inneren Kultur“ - womit wir eigentlich allmählich wieder näher beim Hauptthema wären - aber irgendein Gespür für solcherlei Dinge kann man als Betroffener um so leichter beiseite schieben, als es durch das Selbstvertrauen, das profitable Gewinne erzeugen können, überdeckt werden kann. Die momentane Regierung scheint, milde gesagt, leider ganz besonders ungeeignet zu sein, den „starken Staat“ zu geben, den unsere Gesellschaft bräuchte.
Im Übrigen haben diese wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen indirekt selbstverständlich auch einen Rückgang der Arbeitsmöglichkeiten für alle möglichen Arten von Live-Bands bewirkt. Wobei dem Begriff „Spielsucht“, wenn man unbedingt so wollte, hier ein viel konstruktiverer Charakter zuzuerkennen wäre.
* * *
Das ist, meine ich, eine perfekte Überleitung zurück zum Thema der „Arbeitsmöglichkeiten für Jazzmusiker“.
Jazz war in seinen Anfängen bekanntlich keine Konzertmusik. In den USA ist es bis heute verbreitet, daß zum Beispiel in Restaurants und Bars Live-Jazz geboten wird - übrigens nicht selten ohne der Band besonders weitgehende Vorschriften zu machen, was sie zu spielen habe. Es gibt zwar auch dort die Gepflogenheit von Publikumsanfragen nach bestimmten Stücken, aber die passen in der Regel etwas besser zu dem, was die Band zu spielen in der Lage ist, als das hierzulande vorkommt. Jazz ist in der nordamerikanischen Kultur eben nun einmal stärker verankert. Natürlich ist man als Jazzmusiker auch in den USA unter Anderem deshalb musikalisch vielseitig, weil man auch dort meist nicht nur von konzertantem Jazz leben könnte.
Auch hierzulande war man sich in aller Vergangenheit für gelegentliche musikalische Umrahmungen von Empfängen von Firmen, für Tanz- und Partymusik selten zu schade. Die Realitäten der betreffenden Tanzmusiker-Profi-Szene haben sich allerdings, wie bereits beschrieben, stark verändert. Beispielsweise ist speziell die sogenannte Gala-Szene ziemlich auf den Hund gekommen; auf der „Mucken-“Szene sind Amateure mit Dumping-Angeboten wieder stark auf dem Vormarsch usw.
Im Bereich von Jazz-Clubs hatten sich in den früheren Zeiten etwas mehr Auftrittsmöglichkeiten ergeben als heutzutage. Es gab zwar bereits zu Anfang der 1980er Jahre längst nicht mehr so viele Clubs wie in den Jahrzehnten davor, von denen seither wiederum einige haben schließen müssen, aber es haben auch neuere Clubs eröffnet. Trotz aller Widrigkeiten existiert doch noch immer eine beträchtliche Anzahl von Jazz-Clubs und Festivals. Es sind weniger als in den Achtzigern - allerdings wären einige bestehende Etablissements zu berücksichtigen, die ein regelmäßiges Live-Jazz-Programm durchführen und dabei nicht als Jazz-Clubs in Sinn von öffentlich geförderten Institutionen fungieren. Wie dem auch sei - den wesentlichen Unterschied macht heutzutage vor allem, daß es in der Zeit der 1980er insbesondere weniger Musiker auf der Szene gab - und im Übrigen allgemein etwas mehr konzertante Auftrittsmöglichkeiten.
Inzwischen wirkt sich aus, daß seit etwa Anfang der 1990er Jahre alljährlich ein Schwung gut ausgebildeter Jazzmusiker oder jedenfalls an Jazz-Abteilungen von Musikhochschulen ausgebildeter junger Musiker auf die Szenen strömt. Die versuchen natürlich alle, (in eigener Initiative) Arbeitsmöglichkeiten zu finden - so gibt es also in den Städten eine jeweils größere, sozusagen buntere Auswahl an Musikern.
Nebenbei sei bemerkt, daß auch mehr Musikerinnen dabei sind. Die relative Verspätung in der Zunahme der Anzahl von Musikerinnen auf der Jazz-Szene - insbesondere im eklatanten Vergleich etwa zur Klassik-Szene - ist aber nur bei oberflächlicher Betrachtung verwunderlich. Das wäre jedoch wieder ein eigenes Thema und gehörte ebenfalls zu Betrachtungen, die hier zu weit führen würden.
Die Talent-Förderung ist ja nicht schlecht - es gibt in jüngeren Generationen viel mehr ganz hervorragende Musiker, die oft schon früh zu faszinierend ausdrucksstarken Aussagen finden. Alles in Allem hat die gewachsene Anzahl an zumindest potentiell kreativen Musikschaffenden viele positive Seiten - insbesondere eben solche von größerer Vielfalt an Musik und Inspirationen aus Musik, aber auch an Kontakten der kreativen Szene untereinander. Es ist also ganz einfach etwas mehr los.
Sollte man meinen. So arg weit her ist es damit allerdings nicht, auch wenn es hier und da regelbestätigende Ausnahmen gibt. Die Realität spricht eine etwas andere Sprache - und dazu möchte ich im Folgenden noch einige Anmerkungen machen.
Meine hier einmal auf das Konzertpublikum fokussierte Wahrnehmung umfasst übrigens nicht nur meine (Wahl-)Heimatregion; ich kenne viele Musiker aus praktisch sämtlichen Regionen (hierzulande), in denen es eine Jazz-Szene gibt. Man tauscht sich aus und spricht mitunter eben auch über Themen wie „Jazz-Studenten gehen offenbar selten auf Jazz-Konzerte“. Man könnte hier gleich hinzufügen: höchstens zu ein paar Gelegenheiten, bei denen sie selbst auf der Bühne stehen...
Zu den („außer größere Namen“-)Jazz-Konzerten gehen offenbar tatsächlich zum wenigsten all diese bornierten Damen und Herren Jazz-Studenten - die es doch anginge, wie man meinen könnte (die Quote erhöht sich nach dem Studium offenbar nur sehr leicht - weil, vielmehr: obwohl das Pflichtgefühl dann ja weg ist, nicht wahr?).
Fast dasselbe gilt für Jam Sessions - bei denen die eventuelle, sporadische Anwesenheit dagegen längst nicht bedeutet, daß man sich auf die Bühne bemüht. Einige Studenten sind zu einer Teilnahme an einer Jam Session nur bereit, wenn es darum geht, ihre Hochschulband für eine anstehende Prüfung „tight zu spielen“. Man bleibt - bunte Szene hin oder her - gern so streng unter sich, daß man oft noch nicht einmal die Studenten der höheren respektive tieferen Semester kennenlernt. Das „In-Group“-Verhalten ist zwar verbreitet und sowieso ein evolutionsbiologisch angelegtes Programm bei Primaten, aber ich finde, als möglicherweise kulturell interessierter oder gar kultur-schaffender Homo sapiens sollte man sich gehalten fühlen, beizeiten darüber hinauszuwachsen.
Angesichts der Tatsache, daß man sich in einer Ausbildung zum Jazz-Profi befindet, kann man schwerlich etwas Anderes als ziemlich unziemliche Borniertheit darin erkennen - die mir und vielen meiner Gesprächspartner wahrhaftig seit Jahren Rätsel aufgibt. Liegt es am Eintrittsgeld im Jazz-Club? Mit Ermäßigung auf „Studi“-Ausweis liegt das oft deutlich unter der üblichen „Vergleichsgröße Kinokarte“. Und auf teureren Festival-Konzerten u. ä. sieht man dann plötzlich doch viel mehr Studenten. Bei Jam Sessions wird meist sowieso kein Eintrittsgeld erhoben. Gut, es gibt nicht einfach nur diverses Phlegma - mancher traut sich vielleicht auch garnicht erst, überhaupt mal hinzugehen, geschweige denn einzusteigen.
In jedem Fall ein Fehler - zu einem Studium sollte es dazugehören. Man muß die Mutprobe auf sich nehmen. Schlimmstenfalls kann es zu einem Schritt in Richtung Selbsterkenntnis führen.
Oder - ist meinen Gesprächspartnern und mir bisher etwa entgangen, daß ein großer Teil der Jazz-Studenten im Grunde vielleicht gar nicht viel Anderes vorhat, als Musikschullehrer zu werden und nach Möglichkeit nebenher noch ein bißchen „Mucke“ zu machen? Das könnte wenigstens ein paar Fragen beantworten.
Schlußendlich hätte ich noch eine weitere, ergänzende Erklärung dafür anzubieten, daß innerhalb der Szene nur ein geringer Teil der Jazz-Hochschulstudenten wahrnehmbar ist: mir scheint, daß ein großer Teil - manche sagen gar: die Masse - der Studierenden an „Jazz im eigentlichen Sinn“ praktisch garnicht interessiert ist. Das ist mir von „Insidern“ so auch schon mehrfach bestätigt worden. Das Interesse bezieht sich offenbar vielmehr auf Pop - in mehr oder weniger weiterem Sinn (also sagen wir mal: „Richtung bum tschak, bum bum tschak“). Das wäre eine immerhin schlüssige Erklärung.
Im Übrigen glaube ich, daß, wer dazu bereit ist, schon verstehen wird, wie ich das eben ins Spiel gebrachte Wort von „Jazz im eigentlichen Sinn“ meine. Insofern begnüge ich mich mit Postulierung des Begriffes und dieser Feststellung.
Warum ein Jazz-Studium an einer Musikhochschule für Viele dennoch attraktiv ist, kann ich eigentlich nur vermuten. Vielleicht, weil man an der „Pop-Akademie“ keinen Studienplatz bekommen hat? Oder weil man sich vom Jazz-Studium vor allem die allgemeine Verbesserung seiner instrumentalen/vokalen Fähigkeiten verspricht („dann mal weiter sehen“)? „Jazz“ als Studiengang stünde der musikalischen Interessenlage ja wenigstens irgendwie näher als „Klassik“. Sehr wahrscheinlich - ich meine: eigentlich auch recht verständlicherweise - macht man sich nur sehr vage Vorstellungen vom Berufsbild und, wie gesagt, noch zusätzlich allerhand Illusionen. Ich habe an anderer Stelle bereits Bemerkungen dazu gemacht, daß es scheint, als würden sich Viele erst unmittelbar nach dem Studium nolens volens mit der Realität auseinandersetzen - und habe schon Einige sagen hören, daß sie sozusagen mit dem Erhalt des Diplomes „erstmal in ein tiefes Loch gefallen“ seien.
Schließlich bedeutet es, daß jetzt Berufsleben angesagt ist und so etwas wie „ich muß jetzt ohne Bafög zurechtkommen, also mehr unterrichten und (vor allem) meine Band auf den Markt bringen“. Mit Letzterem sieht es in aller Regel ungeheuer schwierig aus (besonders, wenn es sich um ein „Piano-Trio“ handelt...), weil man sich eben in einer ziemlich großen Masse befindet; daher entstehen auch so viele mühselig um Originalität buhlende Projekte - mit möglichst ungewöhnlichen Instrumenten-Besetzungen, Pseudo-Hommage-Konzeptionen und diversem anderen Krampf. Man nimmt zwar junge Leute in der Veranstalter- und Medien-Szenerie eher wahr als „altgediente Experten“ (es gibt ja auch immer schöne Etiketten zum Drankleben wie „der erst zweiundzwanzigjährige Überflieger“ und dieser ganze Hype-Kram), aber so Viele braucht man davon eben auch wieder nicht. Und sie sind ja Deutsche, daher obendrein meistenteils Weiße, also leider keine US-Amerikaner und sie haben nicht mit Miles Davis gespielt, kaum einmal mit Einem, der mal mit Miles gespielt hat und selbst wenn es Sängerinnen sind, na ja, da sind doch die attraktiven Skandinavierinnen noch immer so in Mode... Es paßt auch gut, daß ja für den verbleibenden, vergleichsweise winzigen Bedarf an inländischen Musikern offenbar immer mehr als genug junge Talente nachkommen, wenn das Verfallsdatum der Vorigen einmal überschritten ist, weil dann das Etikett „Neu“ wieder neu draufgeklebt werden kann (das funktioniert mindestens ebenso gut wie bei Waschmitteln).
Wenn man dann noch den Betrachtungen hinzufügt, daß sich in „den Jazz-Charts“ eigentlich fast ausschließlich Popmusik tummelt, sinken eventuell verbliebene Hoffnungen, sich als Jazzmusiker zu betätigen, noch weiter. Acts wie Nils Landgrens „ABBA“-Interpretationen gehören zu den Wenigen, die irgendwie erfolgreich sind - auch kommerziell (und was wäre das sonst?) - aber sie haben mit Jazz nichts zu tun.
Man muß es halt irgendwie zu einem „Namen“ bringen, um Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen. Ohne einen solchen nützt die beste Akquise nicht allzu viel. Längst nicht nur für „frisch absolvierte Hochschulstudenten“ stellt sich öfters mal die Frage, wie man sich einen Namen erspielen soll, da man (fast) nur zu Spielmöglichkeiten kommt, wenn man (bereits) einen Namen hat?
Es ist extrem frustrierend für frisch absolvierte Hochschulstudenten - und es betrifft ja fast alle, die tatsächlich Jazz spielen wollen - trotz größtmöglichem Einsatz so gegen Wände zu rennen, also nach Jahren der Studienzeit noch einmal so und so lange Zeit alles mögliche an „Herzblut“ nicht nur in die Arbeit an einer leibhaftigen Jazz-Band, sondern auch insbesondere in die Akquise-Arbeit für diese Band zu legen und - wie es die Regel ist - damit grandios und praktisch vollständig zu scheitern. Wenn es gut läuft, kommt das mit kleiner Verspätung, nämlich nach dem Erhalt irgendwelcher Newcomer-Preise (mit denen sich Sponsoren halt gern inszenieren/profilieren).
Ich möchte hier zu rechtzeitiger gedanklicher Beschäftigung anregen, denn ich glaube, daß ein Jazz-Studium per se eine gewisse Art von Isolation - wie soll ich sagen: begünstigt? Beinhaltet? Ich stelle mir vor, daß man eine Reihe seiner jungen Jahre damit verbringt, sich auf diese (oder zumindest „irgendwie artverwandte“) Musik zu konzentrieren und von Leuten umgeben ist, die eben dasselbe tun.
Man lebt in einer Art Nest, auf einer Art "anderen Planeten". „Jazz“ ist tagein, tagaus und von morgens bis abends das große Thema und man vergißt mit der Zeit, daß es Jazz „da draußen“ eigentlich garnicht richtig gibt.
Das beginnen Viele offenbar erst wieder ab dem Tag zu merken, an welchem sie ihr Diplom ausgehändigt bekommen. Das besagte Loch wird um so tiefer, wenn man nicht rechtzeitig, also bereits während der Studienzeit damit begonnen haben sollte, sich um einen Musikschul-Job, „connections“ in der Pop-Szene, einen „principle chair“ in einer Tanzband oder Ähnliches zu bemühen. Wie gesagt: schließlich werden jedes Jahr viel zu viele junge Leute aus den Jazz-Abteilungen diverser Hochschulen entlassen, die vollkommen „am Arbeitsmarkt vorbei“ ausgebildet wurden und natürlich (alle) spielen wollen.
Auch hatte ich bereits an anderer Stelle bemerkt, daß zumindest einige Lehrkräfte an diesen Hochschulstudiengängen ihren Studenten nicht zureichend zu helfen scheinen, sich darauf vorzubereiten, was sie nach dem Studium erwartet: sie (die Lehrkräfte) würden damit ja praktisch ihren eigenen Job konterkarieren; möglicherweise sind Manche auch einfach nicht mehr so recht auf dem Laufenden...
Ein weiteres und eigentlich ganz anderes Problem sehe ich darin, daß diese Ausbildung, so wie sie in aller Regel zumindest hierzulande durchgeführt wird, Musiker mit einem (mehr oder weniger) hohen Niveau an diversen Fertigkeiten ausrüstet, ohne daß sie lernen, wirklich Musik machen zu können. Die Art und Qualität der Erziehung zum Erwerb diverser Fähigkeiten und Fertigkeiten scheint mir für nicht wenige „abstudierte“ Musiker sogar gewissermaßen hinderlich zu sein, wirklich Musik zu machen. („Abstudiert“ ist ein holländische Vokabel, die sich irgendwie in mein Gedächtnis hineingeklebt hat.)
Du kannst, wenn es gut läuft, an einer Schule viel über Jazz lernen, aber nicht Jazz.
Und für das Wort „Jazz“ kann man auch gleich das Wort „Musik“ einsetzen.
Dem wäre höchstens noch hinzuzufügen: das geht nur auf der Bühne und „im Leben“ - also kurz gesagt: live.
Nachträgliche Ergänzung: in einem Filmbericht über "Jazz in Deutschland" für das ZDF von W. G. Bohnes von 1989 (https://vimeo.com/19333664) kommen Joe Haider, Waldi Heidepriem sowie Hermann Rauhe in Interviews zu Wort, die zeigen, wie aktuell das gesamte Thema geblieben ist.
Hochschullehrer Joe Haider hat sehr wahrscheinlich auch schon vor 1989 zur Diskussion gestellt, ob insbesondere Jazz-Unterrichten eher eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Hochschullehrer darstellt, als daß es Studenten eine berufliche Zukunft ermöglicht (heute ist es jedenfalls auch hier in der Rhein-Neckar-Region ziemlich deutlich: es gibt bald mehr Lehrer als Schüler).
Joe Haider sagte in seinem Interview unter anderem: „ ...die meisten Leute - das sind eben Alibi-Übungen - die studieren Musik, Jazz, werden da entlassen, kriegen ein Diplom und werden Lehrer. Wir kriegen immer mehr Lehrer und immer weniger Spieler. Also, sie müssen sich die Existenz ganz anders aufbauen und viel zu viel Energie und Zeit verschwenden, als daß sie sich über ... solche Fragen wie Ästhetik im Jazz Gedanken machen können. ...“
Nach den seither vergangenen 23 Jahren ist es also noch klarer, wer - wie von Haider angesprochen - die Musik weiterentwickeln wird: kaum einer. Das war allerdings schon immer so. Nur ist der Anteil derer, die das auch ganz bestimmt nicht versuchen werden, in der durch das Unterrichten allmählich in´s Absurde vergrößerten Masse all dieser Epigonen eben auch absurd groß geworden.
Wie man wohl bereits bemerken konnte, habe ich eine relativ skeptische Beziehung zu „Institutionen“ im Allgemeinen. Wir passen nicht ohne Weiteres gut zusammen, die Institutionen und ich... Das liegt nun mal in meiner Persönlichkeit begründet und hat sicherlich dazu beigetragen, daß ich als einer der wenigen aus meiner Generation - die ja zeitgeschichtlich bedingt nicht allzu viele professionelle Jazzmusiker hervorgebracht hat - nun einmal nicht in einem dieser Rundfunk-Bigband- oder Hochschul-Jobs untergekommen bin.
Auch hätte ich sicherlich eine Sinfonie-Orchester-Stelle bekommen, wenn ich es darauf angelegt hätte. In meinen Klassik-Studienzeiten hatte ich allerhand solcher Gigs gespielt - insbesondere mein Karlsruher Baß-Professor hatte mich diverse Orchester lanciert. Ich stand sehr auf die Musik und das Spielen im Orchester; es waren sehr schöne Konzerte dabei. Dort habe ich oft mit Profi-Orchestermusikern zu tun gehabt, an denen mir auffiel, daß sie im Gespräch untereinander ständig das Wort „Dienst“ im Munde führten - „ich habe morgen Dienst“, „nächsten Freitag ist dienstfrei“, „können wir am Mittwochabend Dienst tauschen?“ usw. usf. Obendrein ging es noch ständig um kleine Animositäten, Intrigen und sonstwas für Fisimatenten innerhalb des Orchesters, in dem sie nun ihre Lebenszeit verbringen wollten. Wenn ich bloß daran denke, wie sie sich darüber amüsierten, daß ein Baß-Kollege neulich fünf Mark Strafgebühr in die Orchesterkasse einzahlen mußte, weil irgendeiner von den Kollegen ihn mit einer falschen Sockenfarbe erwischt und verpetzt hatte. Das war nicht meine Welt, so wollte ich mein Leben nicht verbringen und vor allem: so wollte ich nicht Musik machen. Freilich habe ich auf Vieles verzichtet...
Ich unterrichte allerdings gern und könnte dies auch an einer Hochschule tun - wenn ich „die richtigen“ Vorgesetzten habe. An der Jazz-Abteilung der Mannheimer Musikhochschule habe ich fünf Semester lang unterrichtet, obwohl ich diese Voraussetzungen dort definitiv und in der Tat nicht vorfinden konnte. Deshalb habe ich dort auch wieder aufgehört. Ich hatte sie (die Voraussetzungen) bislang nur ein Mal, nämlich für etwa fünf Jahre an der städtischen Musikschule in Weinheim/Bergstraße - bis ein neuer Leiter daherkam, der es als Musiker zu nichts weiter als einem verhinderten Rock-Gitarristen gebracht hatte, fortan im dreiteiligen Anzug hinter seinem Schreibtisch thronte und versuchte, sich wichtig zu machen. Seither gebe ich wieder (ausschließlich) Privatunterricht.
Der Anteil der tatsächlich an Jazz interessierten Ex-Studenten genügt jedenfalls, um die Szene kräftig zu inflationieren - die ja, wie erwähnt, bereits in Zeiten vor den neuen Studiengängen im Bezug auf Auftrittsmöglichkeiten alles andere als dünn besiedelt war. In der Tat zählen besagte „Unterrichts-Jobs“ zu den wenigen Ausnahmen an Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt für Musiker, die zahlreicher geworden sind - allerdings gilt das nur für einige Instrumente wie z. B. Saxophon, Gitarre und Schlagzeug. Der darin liegende Aspekt des „Circulus vitiosus“ ist wohl nicht zu übersehen.
Das besagte größere „Angebot“ an guten Musikern auf einer jeweiligen lokalen Szene hat vielgestaltige Nachteile. Die meisten müssen nun nicht mehr (extra) erwähnt werden - einer davon ist jedoch nicht ganz so eklatant und soll angemerkt sein: zusammen mit dem Blick auf steigende Reisekosten, recht unterschiedliche Gagen und durchschnittlich weniger Arbeitsmöglichkeiten pro Musiker wird im Rückblick auf eine längere Zeit deutlich (sagen wir: zehn, fünfzehn Jahre), daß der Austausch zwischen Musikern aus verschiedenen Städten bzw. Regionen deutlich zurückgeht. Es war bis in die 1990er Jahre noch um Einiges normaler und üblicher, daß Mitglieder einer Band aus diversen Regionen zusammenkamen. Überregionale Auftritte bzw. Tournéen zu organisieren war etwas weniger problematisch. Seit einiger Zeit habe ich jedoch den Eindruck, daß „die Städte sich einigeln“. Freilich, wenn das Budget für den Gig „low“ ist, kommt man wohl ins Überlegen, ob man z. B. den tollen Drummer engagiert, der in 2x150 km Entfernung wohnt...
In letzter Zeit gibt es mehr „Door-Gigs“, mehr Jam Sessions (bei denen die Gagen für die „Haus-Band“ eher einen symbolischen Obolus im Sinne einer Aufwandsentschädigung darstellen) und mehr Kneipen-“Mucke“, bei der man sehr preisgünstige Live-Background-Musik für ein Lauf-Publikum zelebriert. Es gibt obendrein auch Kombi-Versionen bis zu „Alles von den Dreien gleichzeitig“.
O. k.,
Kneipen-Gigs können auch gut Spaß machen; eine öffentliche Probe kann recht nützlich sein - aber wenn zu alldem, sagen wir mal, die Pausenmusik zwischen den Sets auf SWR3-Qualitätslevel und mindestens so laut wie die Band ist und dann vielleicht noch irgendwelche Hanseln aus dem Publikum mit völlig konträren und bekloppten Wünschen nach bestimmten Musikstücken angewackelt kommen, könnte mir das doch etwas den Wind aus den Segeln nehmen.
In all solchen Szenarios kann man freilich kein Lebensziel entdecken; man sollte natürlich garnicht erst versuchen, von solchen Auftritten zu leben. Wenn man vielleicht mal für eine Jam Session zum Beispiel von Frankfurt nach Mannheim fährt, ist das zwar prima, aber man muß es sich halt auch leisten können - zum Beispiel mithilfe eines Unterrichts-Jobs. Wenn man allerdings zu viel unterrichtet, bleiben Band-Projekte und die eigene musikalische Weiterentwicklung auf der Strecke und es sind irgendwann nur noch solche Möglichkeiten übrig, live zu spielen - da beißt sich die Katze geradewegs in den Schwanz.
Die „Balance“ aus Anzahl der Auftritte, der Gelegenheiten, konzertante Musik zu machen, der (mehr oder weniger üblichen) Gagenhöhe, des durchschnittlichen Schwierigkeitsgrades, ein Engagement zu bekommen mitsamt der Preise für Reisen, Wohnen und Leben und der allgemeinen Kaufkraft des Geldes hat sich jedenfalls geändert.
Obwohl ich im Grunde überhaupt nicht so pessimistisch bin, wie es möglicherweise den Anschein haben könnte, habe ich gute Lust, an dieser Stelle den großartigen Karl Valentin (1882-1948) zu zitieren: “Hoffentlich wird´s nicht so schlimm, wie´s schon ist.“
* * *
Über Akquise von Arbeitsmöglichkeiten im Bereich
musikalischer Dienstleistungen (Firmen- und Privatveranstaltungen)
Da ich schon einmal dabei bin, möchte ich diesem Kapitel ein weiteres Valentin-Zitat voranstellen:
„Optimist: ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind.“
Da auch ich von irgendetwas leben muß, habe ich verstärkt angefangen, ein Band-Projekt zu pflegen, das sich für ein gewisses Spektrum an musikalischen Dienstleistungen eignet.
Ich schätze mich glücklich, inzwischen seit Jahrzehnten im Bereich der Jazz-Szene professionell tätig zu sein, kann jedoch nicht mehr in gewohnter Weise davon ausgehen, von Bandleadern, mit denen ich zusammenarbeite, für mein wirtschaftliches Überleben ausreichende Engagements angeboten zu bekommen. Das war nicht immer so. In der Tat war es mir von etwa der Mitte der 1980er Jahre bis etwas über die Jahrtausendwende hinaus (also immerhin knapp zwanzig Jahre lang) möglich, im Großen und Ganzen darauf zu bauen, daß mein Telephon oft genug klingeln würde, so daß ich von „Sideman-Gigs“ leben könnte. Mein Berufsbild resultierte so ziemlich aus der Mischung von diesen „Sideman-Gigs“ mit einem in zeitlicher Hinsicht überschaubaren Maß von Unterrichtstätigkeit sowie ggf. Touren mit eigenen Projekten.
Als sich das Bild änderte, war es letztlich nur eine Frage der Vernunft, gewisse Weichen anders zu stellen - ich habe mich also, wenn man so will, für eine Art Reform entschieden und meine Arbeitsweise (nicht etwa meine Ziele) entsprechenden Abänderungen unterzogen. Im Übrigen war es offenbar ebenfalls vernünftig, dem Großen und Ganzen gegenüber eine gewisse Gelassenheit zu bewahren.
Ich könnte meiner Musik - also der, die mir am meisten Herzen liegt - nicht mehr ausreichend nachgehen, wenn ich im kommerziellen Bereich nicht etwas täte, das ich im Prinzip sowieso schon kann. Allerdings besteht ungefähr das größte Problem darin, dafür Arbeitsmöglichkeiten zu akquirieren. Darin sehe ich trotz vielerlei Bedenken eine Aufgabe.
* * *
Es gibt zwar viele Parallelen, aber zwei Dinge unterscheiden diese „Kommerz-Band“-Akquise grundlegend von der im Jazzbereich: es geht in der Regel von vornherein um einen bestimmten feststehenden Termin und insbesondere sind meine Ansprechpartner oft telephonisch erreichbar. Zumindest zu durchschnittlichen Bürozeiten.
Für einen privaten oder Firmen-Event-Termin werden in der Regel über Internet-Seiten mehrere Bewerbungen geprüft und Privatleute melden sich dann manchmal sogar, um Details zu diskutieren usw. Es gibt sogar solchen Bewerbungen gegenüber, die aus der Auswahl ausscheiden - noch ist es jedenfalls verbreitet - ein durchschnittlich höheres Verantwortungsbewußtsein, in dem Fall auch eine Absage zu senden. Damit entfällt, wie schon erwähnt, ein nicht zu unterschätzender Teil meiner zeitintensiven und konzentrationsaufwendigen Büroarbeit. Wohlverstanden trifft das, wenn überhaupt, praktisch nur für Privatleute zu; Firmen-Ansprechpartnern muß man (ansprechenderweise) hinterhertelephonieren.
Sätze wie „wir melden uns in den nächsten Tagen“ fallen häufig, liegen im Aussagewert jedoch nur knapp über Null. Die in der Floskel enthaltene Bedeutung variiert irgendwo zwischen „wir melden uns garantiert auf keinen Fall, das versprechen wir Ihnen“ - hier wiederum irgendwo zwischen: „kein Interesse, die Sache hat sich erledigt“ und: „keine Zeit zum Musikhören, wo denken Sie hin, bin völlig überlastet mit wichtigeren Dingen; die Entscheidung wird vertagt, keine Ahnung, auf wann, probieren Sie es halt irgendwann später nochmal“ - bis etwa zu einer Aussage wie: „Ihr Zeug gefällt uns irgendwie ganz gut, aber wir rufen Sie trotzdem nicht an. Besser, Sie melden sich in den nächsten Tagen nochmal, damit wir nicht so dastehen, als wollten wir etwas von Ihnen“. Oder so ähnlich.
Natürlich gibt es z. B. infolge der Unerfahrenheit insbesondere privater Veranstalter immer einiges an organisatorischem Zusatzaufwand, aber man kann wenigstens mit den Leuten reden oder zumindest mailen. Meistens, jedenfalls. Es gibt in der Tat auch in diesem Bereich eine zunehmende Gedanken- und Teilnahmslosigkeit im Umgang mit Bewerbungen bzw. Bewerbern, durch die sich die Arbeit in diesen Bereichen teilweise den bislang noch unterschiedlichen Merkmalen der „Jazz-Akquise“ nähert.
Im Bereich der Akquise von Auftritten insbesondere bei Firmen-Events nimmt die Art des Umgangs mit Musiker-Bewerbungen mitunter bereits den Charakter einer Art pampiger Borniertheit an - man kann es eigentlich nicht anders sagen. Der „neo-liberale“ Stil der „Heuschrecken“-Szene scheint auch hier einen Einfluß auf Zeitgeist, Bildungsstand und allgemeines Benehmen zu haben. Solcher Stil ist im Bereich der Jazz-Szene zum Glück äußerst selten anzutreffen und stellt insofern, wenn man so will, eine weitere Unterschiedlichkeit dar. Man mag es für übertrieben halten, wenn ich hinzufüge, daß man wiederum eher eine Parallele darin erkennen könnte, daß auch manche private oder Firmen-Veranstalter ihr „kleines Ego“ daran aufzurichten versuchen, einen Bewerber als Bittsteller zu behandeln und insofern eine Art „Arroganz der Macht“ an den Tag legen - meine Erfahrungen legen diesen Eindruck nahe.
Im Werbeslogan „Geiz ist geil“ ist ein weiteres Zeitgeist-Element ausgedrückt, das in allen gesellschaftlichen Bereichen deutliche Spuren hinterlassen hat. Eine entsprechende Mentalität auf der Ebene von Firmengebaren ebenso wie in privaten Geisteshaltungen ist damit recht prägnant und anschaulich umschrieben. Spätestens seit Aufdeckung von allerhand Betrügereien größeren Stils insbesondere in der Bauwirtschaft ist es zumindest in betuchteren Gesellschaftskreisen weniger opportun, größere Investitionen als „Peanuts“ zu bezeichnen. Salonfähig wurde dagegen, mit Sparsamkeit anzugeben, wobei man das Gefühl haben kann, daß solche kleinbürgerlichen Attitüden auch als Tarnung, jedenfalls zu dezentem „Understatement“ eingesetzt werden. Es wirkt zur Zeit nicht mehr besonders peinlich, wenn die rotgefärbte oder erblondete Gattin im Segelclub-Partygespräch damit angibt, das allergleiche T-Shirt, für das sie „letztens“ bei Engelhorn & Sturm noch neunzig Euro bezahlt habe, jetzt bei H & M für dreißig „gefunden“ zu haben. Spätestens anhand dieses Beispiels sollten gewisse gesellschaftliche Entwicklungen der jüngeren Zeit erkennbar werden. Im Weiteren kann man sich vor diesem Hintergrund sicherlich gut vorstellen, wie über Ausgaben im Kulturbereich gedacht und gehandelt wird.
Eine recht fatale Mischung aus all solchen Attituden ist leider und mit steigender Tendenz insbesondere unter relativ jungen Firmenmitarbeitern festzustellen.
Die Tatsache, daß die Organisation von Live-Musik für Firmen-Events immer häufiger in die Hände von firmenzugehörigen Auszubildenden gegeben wird, führt jedenfalls zu einigen diesbezüglichen Beobachtungen. Ich fürchte, dieser bornierte Stil wird auch dazu eingesetzt, zu verbergen, daß die Aufgabe (der Beschaffung von Live-Musik für Events) mitunter schlichte Überforderung bedeutet.
Natürlich habe ich Verständnis für den ungeübten Umgang junger Leute mit der Materie. Durch die „Einzigartigkeit“ des Termins bleibt die Sache ja auch irgendwie überschaubar - steht der Termin kurz bevor oder ist er gar verstrichen oder bekomme ich für meine Event-Band ein anderes Angebot, hat sich die Sache eben schlicht und einfach erledigt.
Normalerweise verständige ich unsere Klienten über die terminlichen Grenzen, bis zu denen unser Angebot freigehalten werden kann. In einigen Fällen habe ich allerdings auch ein wenig „experimentiert“ - ich wollte meine Akquise-Erfahrungen zu dem Spezialthema „Live-Musik-Buchung mit Firmen/Agenturen über deren Azubis“ etwas erweitern.
Die Ergebnisse waren aufschlußreich, aber nicht gerade ermutigend - besonders, falls sie repräsentativ sein sollten. Deshalb sollen hier einige Worte darüber gesagt sein - vielleicht können solche Informationen ja Irgendjemandem von Interesse sein.
Es sieht in der Tat so aus, daß die Kontaktaufnahme und der weitere Kontakt zwischen uns und einer auftraggebenden Firma, die von deren Auszubildenden repräsentiert wird, mitunter relativ schwierig werden kann. Die Problematik ließe sich mit den folgenden Beispielen skizzieren:
Nicht selten sind mehrere Azubis gleichzeitig mit derselben Aufgabe betraut, die sich obendrein oft unzureichend untereinander koordinieren; manchmal sind die Kompetenzen von vornherein nicht klar geregelt. Die Bewältigung der Aufgabe hat mitunter den offenbaren Charakter einer Übung im Rahmen der Ausbildung. Vielleicht hat man den Eindruck, daß „Live-Musik-Beschaffung für ein Firmen-Event“ ein geeignetes Feld zum Management-Training für Auszubildende sei? Die Gründe würden mich interessieren. Ich habe noch nichts Gesichertes darüber herausfinden können, glaube aber trotzdem, daß genau das (Event-Musik-Beschaffung als Lern- und Trainingsmaßnahme) tatsächlich des Öfteren vorkommt.
Immer häufiger fällt den mit der Aufgabe Betrauten nichts Besseres ein, als ein relativ unpräzises Gesuch-Inserat bei Internet-Plattformen wie „partymat.de“ oder „partyprofi.com“ aufzugeben - die verbreitete Gewohnheit, Waren im Internet zu bestellen, hat hier offenbar prägenden Einfluß.
Dabei werden allerdings oft völlig unbrauchbare Angaben zur gewünschten musikalisch-stilistischen Ausrichtung der Band gemacht - manchmal werden anscheinend so gut wie alle vorgegebenen Möglichkeiten angehakt. Hin und wieder sind sogar Teile der Kontakt-Daten und andere Daten zur Veranstaltung fehlerhaft eingegeben. Die Angaben zum Rahmen des Budgets sind in der Regel völlig unrealistisch - etwa in dieser Art: „Alleinunterhalter oder DJ oder Duo oder Trio oder Quartett - von 16 Uhr bis ? von 200 bis max. 700 Euro“. Anscheinend denkt man sich nichts dabei - es sieht danach aus.
Schilderung: in einem Fall hatte nicht einmal die Telephonnummer der Firma im Inserat bei „plan-dein-fest.de“ gestimmt - ein Anruf war mir erst gelungen, nachdem ich den Namen der Firma im Internet über die Domain-Endung der angegebenen Mail-Adresse herausgefunden hatte. Es handelte sich, glaube ich, immerhin um „Heidelberg Cement“ - oder war es „Bilfinger & Berger“? - jedenfalls eigentlich eine respektable Firma; man hatte in diesem Fall offenbar keine Sorge, sich über seine Azubis in diesem Fall recht wenig respektabel darzustellen. Es ging - so viel konnte ich herausfinden - um Musik für ein „Event für ehemalige Mitarbeiter“, das „irgendwann, eher so Nachmittag, früher Abend“ stattfinden sollte. Die beauftragte Mitarbeiterin war nach eigener Aussage bereits mit knapp 100 Zuschriften und trotz fehlerhafter Angabe der Telephonnummer mit entsprechend vielen Anrufern konfrontiert - was ich insgeheim stark bezweifelte. Ich wurde zweimal an andere Mitarbeiterinnen weitergeleitet („ich bin nämlich nächste Woche nicht da“), hatte es daraufhin also mit Dreien von der Sorte zu tun.
Die hatten natürlich alle eigene Durchwahlnummern und Mailadressen - „schicken Sie das Anschreiben doch nochmal vorbei“. Damit war das Durcheinander offenbar perfekt; nach außen hin legten sie allerdings eine recht blasiertes Überlegenheitsgehabe an den Tag. Im Weiteren zeigte man ziemlich genau das Maß an Hohlköpfigkeit, wie es der erwähnte erste Eindruck hatte vermuten lassen. Von den drei Prinzesschen tat sich darin die vermutliche - auch das wurde nicht recht klar - Haupt-Beauftragte besonders hervor. Das erschien mir an und für sich relativ logisch, weniger naheliegend war ihre beeindruckende Ratlosigkeit nach meiner Antwort auf ihre vorangegangen Frage, was für Musik wir denn „so alles“ machen würden. Ich hätte vielleicht Band-Namen statt Musikstile nennen sollen; jedenfalls hatten die nach mehreren Telephonaten entweder unsere Home Page noch nicht gesichtet oder waren vielleicht sogar zu beschränkt, den Player darauf zu betätigen.
Die Aufgabenstellung muß jedenfalls komplettes Chaos verursacht haben. Ich hoffe, daß sie nur die Live-Musik umfaßt hat; kann mir jedenfalls vorstellen, daß darüber nach Wochen und Monaten kurz vor dem Event-Datum auf die Schnelle nach Preis entschieden worden ist. Vielleicht mußten sich die ehemaligen Mitarbeiter in einer Werkshalle bei Kaffee und Marmorkuchen („... kann Spuren von Erdnüssen enthalten ...“) mit hirnlosem Techno-Teenie-Pop aus dem dürftigen Bestand eines kettenbehängten Wochenend-DJ arrangieren? Ich sehe es bildhaft vor mir, mitsamt Neonröhrenlicht und orange-grünem Klapp-Mobiliar. Die Tische mit Papier bezogen, mit Firmenlogo drauf (ich sehe sogar die Reißzwecken).
So viel dazu; das dürfte wohl als Beschreibung genügen.
Diesen Kontakt (und ein, zwei weitere) hatte ich, wie schon erwähnt, aus Interesse daran, meine Akquise-Erfahrungen zu dem Spezialthema „Live-Musik-Buchung mit Firmen/Agenturen über deren Azubis“ etwas zu erweitern, länger aufrechterhalten. Den beschriebenen Fall hatte ich über etwa zehn Wochen lang bearbeitet, bevor ich die Sache ergebnislos abgebrochen habe - es wurde mir irgendwann dann doch einfach zu dumm.
Man sollte „Geist ist geil“ als Alternative empfehlen.
Die Alternative zum Gesuch-Inserat auf dem Internet-Portal wäre gewesen, selbst bzw. eigenständig zu recherchieren oder wenigstens spezialisierte Agenturen zu konsultieren. Tatsächlich ist die Auftragslage in großen Teilen der Agentur-Szene rückläufig - dafür floriert ein ständig wachsender, unangenehmer Markt von Adressen-Verkäufern: ein Gesuch-Inserat auf einem Internet-Portal wie „event-helden.de“ o. ä. ist kostenfrei, jeder Abruf einer Inserenten-Kontakt-Adresse wird von den vielen konkurrierenden Live-Musik-Anbietern jeweils individuell bezahlt. Ein relativ sicheres Geschäft für die „Pseudo-Agentur“ - die eine solche Kontaktadresse zum Inserenten x-mal verkaufen kann (die Gebühren bewegen sich zwischen € 1,90 und ca. € 5.- pro Kontaktadressen-Freischaltung).
Es ist klar, daß es für Leute, die auf der Suche nach einer Live-Musik-Band sind, sehr einfach ist, auf diese Weise Angebote einzuholen. Man sammelt erst einmal und bucht im Endeffekt die billigere Band. Das ist ja auch legitim.
Da wir uns preislich irgendwo im Mittelfeld bewegen - und nicht bereit sind, uns in den Preis-Kampf der niederen Regionen zu begeben - bekommen wir den Zuschlag selbstverständlich seltener. Es ist im Übrigen ein unerfreulicher Markt, sowohl die Qualität der Angebote betreffend (die oftmals unfaßbar schlecht ist), wie auch die Quantität - der Kunde wird mit teilweise mehr als 100 Angebote aller Couleur überschüttet und hat dann die Arbeit, die alle zu sichten - wobei u. a. das Beantworten der Angebote oft vernachlässigt wird, so daß wir nicht wissen, woran wir sind. Oft wird vergessen, das Inserat zu löschen, nachdem das Gesuchte gefunden wurde, so daß Musiker die Adressenfreischaltung weiterhin kaufen usw. usf. Zu erwähnen wäre hier auch noch die Unverfrorenheit der (Dumping-)Preispolitik vieler insbesondere nebenberuflicher Service- und Musik-Anbieter.
Unsere Akquise ist durch diese um sich greifende Live-Musik-Beschaffungsmethode teuer und zeitintensiv geworden; obendrein bezahlt man in Gestalt dieser Makler sozusagen die falschen Leute für eine unreelle Leistung. Wie gesagt: eine eigene Recherche oder wenigstens eine Zusammenarbeit mit entsprechenden „richtigen“ Agenturen, die ihre Provision erst im Erfolgsfall kassieren, ist etwas anderes als die zeitraubende Beschäftigung mit dem Massen-Material solcher oft branchenfremden Abstauber.
Wenn die Recherche nach musikalischer Umrahmung von Firmen-Events auf diese Weise betrieben wird, geht der organisatorische Überblick mindestens genauso oft flöten - was wiederum insbesondere Azubis halt relativ häufig passiert. Zudem ist der Bildungs- und Informationsstand, der hier relevant wäre, oft auf so unterirdischem Niveau, daß irgendwelche zur Recherche notwendige Beurteilungskriterien für die passende Musik kaum vorhanden sind.
Die Firmenleitung hat vielleicht geglaubt, den jungen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit der Auswahl der Live-Musik eine angenehme Aufgabe gestellt zu haben. Es wird zudem von höheren Chargen möglicherweise eine Art Prestigeverlust befürchtet, wenn man sich höchstselbst mit „weichen Werten“ wie dem kulturellen Teil eines Firmen-Events befassen müßte; man kann sich ja obendrein prima blamieren, falls man nicht die passende Auswahl an Musik getroffen haben sollte (ein allein nach Kosten-Optimierung engagierter Freizeit-Plattenleger in DJ-Maskerade mit niederfrequentem Gehämmere kann, wenn nicht schon sowieso, spätestens zwischen Redebeiträgen auf einem Fach-Symposium ganz schön kläglich wirken). Das Risiko solcher Armutszeugnisse überläßt man sicherheitshalber wohl lieber den Azubis. Andere Organisationsbereiche eines Firmen-Events wie Catering, Location und Logistik werden den Auszubildenden offenbar weit seltener überlassen ...
So oder so: die ja doch letztlich auf einer gewissen kulturellen Bildung beruhende Urteilsfähigkeit der jungen Leute wird oft überschätzt, die Schwierigkeit der Organisationsaufgaben dabei unterschätzt.
Die Fluktuation der mit diesem Aufgabenbereich betrauten Auszubildenden ist hoch - so bleiben sie nur eine begrenzte Zeitlang in der Position als Ansprechpartner für uns. In der Regel sind also beim nächsten Event längst ganz andere (neue) Personen mit der Organisation beauftragt - die auf das Material der Vorgänger übrigens oft nicht mehr zurückgreifen - das wenig konstruktive, aber profilierungs-effektivere Procedere, in einer neuen Position als so ziemlich erste Maßnahme eigene Systeme und Daten einzuführen und die Ressourcen der Vorgänger in Archive zu verbannen, scheint interessanterweise in vielen Betrieben schon früh gelernt bzw. angewendet zu werden. Vielleicht ist das Thema ja auch ein Bestandteil des Management-Trainings im Rahmen der Ausbildung ...
Na ja, auch bei „Privatleuten“ kommen schon mal krasse Dinge vor.
Schilderung: so haben sich für eine Gesuch-Aktion bezüglich Hochzeits-Band zwei angehende Brautleute in vielversprechendem „Teamwork“ getrennt auf die Pirsch begeben - der eine hat bei, sagen wir, „Plan-Dein-Fest“ und der Andere bei „Partymat“ inseriert. Ich bin darauf hereingefallen - d. h. ich habe beide Kontaktadressen gekauft und anhand meiner Liste erst später festgestellt, daß es sich um denselben Termin am selben Ort unter zwei Namen handelte. Die hatten in dem Fall sogar ihre Telephonnummer angegeben - und so habe ich die „konzertierte Aktion“ eigentlich erst bemerkt, als ich bei der zweiten Kontaktadresse auf demselben Anrufbeantworter gelandet bin.
Übrigens geben viele „Private“ nur eine Mail-Adresse in ihrem Gesuch-Inserat an (also keine Telephonnummer). Toll, und das ist dann oft so eine Wegwerf-Adresse wie, sagen wir mal, „die-meiers-hochzeit@web.de“ oder „ritaundheinzi@gmx.net“ oder sowas - die dann nach ein paar Tagen abgeschaltet ist, weil die Herrschaften zu Ihrer Überraschung hundertdreizehn Zuschriften bekommen haben, von denen sie wegen Streß eh den größten Teil nicht beantworten. Das obsolete Inserat wird natürlich nicht abgeschaltet bzw. gelöscht. Dabei nehmen sie in Kauf, daß die Musiker bis kurz vor dem unseligen Termin dem Herrn Partymaten scharenweise diese dämliche Kontaktadresse abkaufen und damit ganz sicher zum Scheitern verurteilt sind. Gedankenlosigkeit allerorten.
Derlei Geschichten und gibt es noch viele. Ich will mich damit fürs Erste begnügen. Umfassend kann ein solcher Text ohnehin niemals werden - sollte er auch nicht. Man glaubt vielleicht hin und wieder, daß man praktisch alle Fährnisse und Untiefen bereits kenne, erlebt aber zur eigenen Überraschung doch immer wieder mal etwas Neues.
Ich hoffe jedenfalls, daß sich noch allerhand verbessern lassen wird; man darf wohl gespannt sein.
Also, so weit mal eben dazu ;-)
* * *
Ungefähr 99 Nachwörter
Der vorliegende Text ist aus Materialien entstanden, die auch zu einem anderen Projekt gehören. Dessen Verwirklichung liegt in zur Zeit noch nicht näher bestimmbarer Zukunft. Im Ergebnis dürfte das Ganze nach Fertigstellung irgendeine Art von Roman sein, in den dieses Material also auch eingearbeitet wird - freilich in völlig anderer Form. Den Text in der hier vorliegenden Essay-Form veröffentliche ich vor diesem „anderen Projekt“, weil bestimmte zeit- und zeitgeist-bezogene Inhalte in absehbarer Zeit nicht mehr aktuell sein werden.
Auf ein Erscheinen des hier einmal so genannten „Romans“ werde ich natürlich zu gegebener Zeit an geeigneter, anderer Stelle hinweisen.
Johannes Schaedlich (17. Oktober 2009; zuletzt überarbeitet am 02. März 2010)
„Das Dumme ist, daß Essays sich immer so anhören müssen, als spräche Gott für die Ewigkeit, obwohl es nie so ist. Die Leute müssen begreifen, daß es nie etwas anderes ist als ein bestimmter Mensch, der von einem bestimmten räumlichen und zeitlichen Standort aus spricht, aus bestimmten Verhältnissen heraus. ...“
Robert M. Pirsig
* * *
Anhang
In meiner Schublade fand sich noch eine Skizze, die mir hier ganz gut zu passen scheint. Ich hatte zunächst festgestellt, daß es zur Erläuterung der Bedeutung des Wortes „Hip“ bei „Wikipedia“ (freie Internet-Enzyklopädie) keinen vernünftigen Artikel gibt. Auch andere ansonsten recht qualifizierte, verwandte Artikel wie „Hipster“, „Hippie“ etc. erklären das zugrundeliegende Wort nur sehr unzureichend. Daher habe ich „Wikipedia“ den folgenden Artikel zur Verfügung gestellt (Link zum Artikel ebendort) und ihn außerdem hier als Anhang plaziert.
Letzteres hat auch den Grund, daß „Wikipedia“-Einträge im Lauf der Zeit und in mehr oder weniger gegebenen Fällen der relativ rigorosen Bearbeitung eines Kreises von Redakteuren - sogenannter Administratoren - unterliegen. Es kommt vor, daß Artikel je nach Gusto der Redakteure zusammengestrichen oder auch mitunter gelöscht werden. Mir genügt es, daß ich mich engagiert habe - ich möchte mich nun nicht weiter groß darum kümmern und lege ich den Text hier in meiner Originalfassung (vom 19. März 2010 um 15:04 Uhr) vor:
„Hip“?
Es ist ein adjektivischer, ursprünglich in der afro-amerikanischen Umgangssprache der USA entstandener Begriff, der etwa seit den 1960er Jahren in einen internationalen Sprachgebrauch übergegangen ist.
Außerhalb der USA gilt er als ein Begriff der Jugendsprache.
Wortbedeutung
Die Bedeutung der Eigenschaftsbezeichnung „hip“ ist vielschichtig und war im Laufe der Zeit einigen Wandlungen und Nuancierungen unterworfen (s. auch: Joachim Ernst Behrendt - Ein Fenster aus Jazz - Essays, Portraits, Reflexionen, Seite 258 ff. Fischer TB Verlag, Frankfurt a. M. 1978).
„Hip“ wird heute überwiegend in Bedeutungen etwa von „angesagt“, schick, zeitgenössisch, „trendy“ genutzt.
Ältere Bedeutungsqualitäten mit positiv bewertendem Gehalt im Sinn von „hoch entwickelt“, „weltklug“, „fortschrittlich“, „geistvoll“, „ausgefeilt“, „geschmackvoll“ und „angenehm“ sind weniger verbreitet, jedoch im Unterton des aktuellen Sprachgebrauchs oft noch in gewissem Maß enthalten. Insofern kann „hip“ in Nuancen ähnliche Bedeutungen zu den ebenfalls vorwiegend jugendsprachlichen Begriffen „cool“ oder in neuerer Zeit auch „geil“ annehmen.
Mitunter befinden sich sämtliche dieser Begriffe in nahezu simultanem Gebrauch und unterliegen daher zunehmender Nivellierung von ursprünglich vorhandenen Bedeutungsunterschieden, die somit teilweise nur dem jeweiligen Sinnzusammenhang oder dem Unterton einer Aussage entnommen werden können.
Im Übrigen ist das Wort „hip“ mit dem englischen Wort für „Hüfte“ zwar aussprachlich ähnlich bis mitunter identisch, hat damit jedoch in seinem Bedeutungsinhalt nichts zu tun, da es sich aus einem Begriff der afro-amerikanischen Umgangssprache ableitet, der in Schreibweise und Aussprache zuerst als „hep“ auftauchte. Bei späterer Schreibweise als „hip“ variiert die Aussprache insbesondere im amerikanischen Englisch nach wie vor zwischen beiden Formen.
Entstehungs- und Bedeutungsgeschichte
Der Begriff „hep“ ist als Vorläufer der Variante „hip“ in den 1920er Jahren in den USA in Kreisen der afro-amerikanischen Jazz-Szene entstanden. Er diente als vielschichtige Umschreibung gewisser Lebensweisen und -einstellungen, Geisteshaltungen, zunächst auch der Verbundenheit zum afro-amerikanischen Jazz und insbesondere zum Rhythmusgefühl des Swing. Wer diese Einstellungen teilte, wurde als „Hep Cat“ (oft in einem Wort als „Hepcat“ geschrieben) oder auch kurz als „Cat“ bezeichnet. Das Wort „Cat“ wird insbesondere unter Jazzmusikern auch heute noch in dieser Bedeutung verstanden, in anderen Kreisen allerdings vorwiegend in der Bedeutung von „(beliebiger) Person“ als eine Art Alternative zum englischen Wort „Guy“ = „Typ“. Der Gegenbegriff zu „hip“ wurde mit „square“ bezeichnet, das so viel wie „spießig“, „zickig“, „beschränkt“, auch „linkisch“ bedeutet und damals oft substantivisch als allgemeine Bezeichnung für einen Angehörigen der weißen amerikanischen Bevölkerungsschicht gebraucht wurde.
In den 1950er Jahren hatte der aus „hep“ mittlerweile zu „hip“ geformte Begriff Eingang in den Sprachgebrauch auch eines Teils der weißen US-amerikanischen Jugend gefunden, die in einem stark konservativen Klima der Gesellschaft bestrebt waren, zu fortschrittlicheren Haltungen zu finden. Im Zuge dieser Intentionen, zu denen insbesondere die Überwindung der noch immer tiefgehend etablierten Rassentrennung gehörte, entstand eine geistige Strömung, deren Anhänger sich als „Hipster“ oder auch „Beatnik“ zu bezeichnen begannen und ihre schwarzen Altersgenossen in vielerlei Hinsicht nachzuahmen versuchten.
Eine der Haupt-Stimmen dieser Bewegung, der Autor Norman Mailer, formulierte 1957 die inhaltliche Interpretation Begriffe „hip“ und „square“ in einem Essay als Gegensätze in Geisteshaltungen und Lebeneinstellungen folgendermaßen:
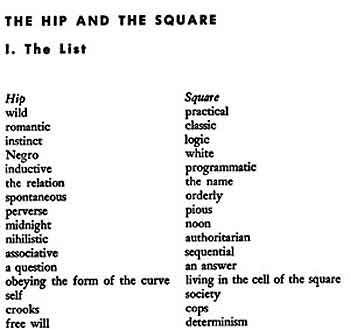 |
Norman Mailer: „The Hip and the Square: 1. The List“ -
aus „Advertisements for Myself“. Putnam’s, New York 1959 |
Das von „Hipster“ abgeleitete Wort „Hippie“ entstand als verächtliche, spöttisch verniedlichende Bezeichnung - teils verwendet von aufgebrachten US-Bürgern, die zumeist der konservativen, weißen Gesellschaftsschicht angehörten und den oppositionellen Geisteshaltungen der „Hipster“-Bewegung feindselig gegenüberstanden, teils von den „Hipstern“ und „Beatniks“ selbst, die sich als eine Art geistige Elite empfanden und den Ausdruck als herablassend gebrauchte Bezeichnung für Nachahmer im Sinne von „Möchtegern-Hipster“ benutzten.
Aus den „Hipster“- und „Beatnik“-Strömungen entwickelte sich eine neue Jugendbewegung mit im Gegensatz zu deren politisch relativ diffusen Haltungen deutlicheren politischen Stellungnahmen, die insbesondere durch immer entschiedenere oppositionelle Haltungen der amerikanischen Jugend zum Vietnam-Krieg beeinflußt waren. Diese neue Bewegung machte sich die Bezeichnung „Hippie“ zu eigen; sie fand in der Mitte der 1960er Jahre insbesondere von San Francisco aus eine rapide, auch internationale Verbreitung. In Westeuropa hatte die „Hippie“-Bewegung der US-amerikanischen Westküste starken inspiratorischen Einfluß und war ein Auslöser der Kulturrevolution der „68er-Bewegung“.
Nachtrag: der Begriff „Zickendraht“ ist - zumindest auch - eine deutsche Entsprechung zum US-amerikanischen Begriff „square“ (der ja auch in substantivischer Form gebräuchlich ist).
Ich kenne es als ein Synonym für einen Jazz-Musiker, der nicht gut, insbesondere rhythmisch hart, kantig, linkisch, steif, und damit nicht „hip“ spielt (phrasiert).
* * *
„Je näher man ein Wort anschaut, desto ferner schaut es zurück.“
Karl Kraus (1874 - 1936)
|

















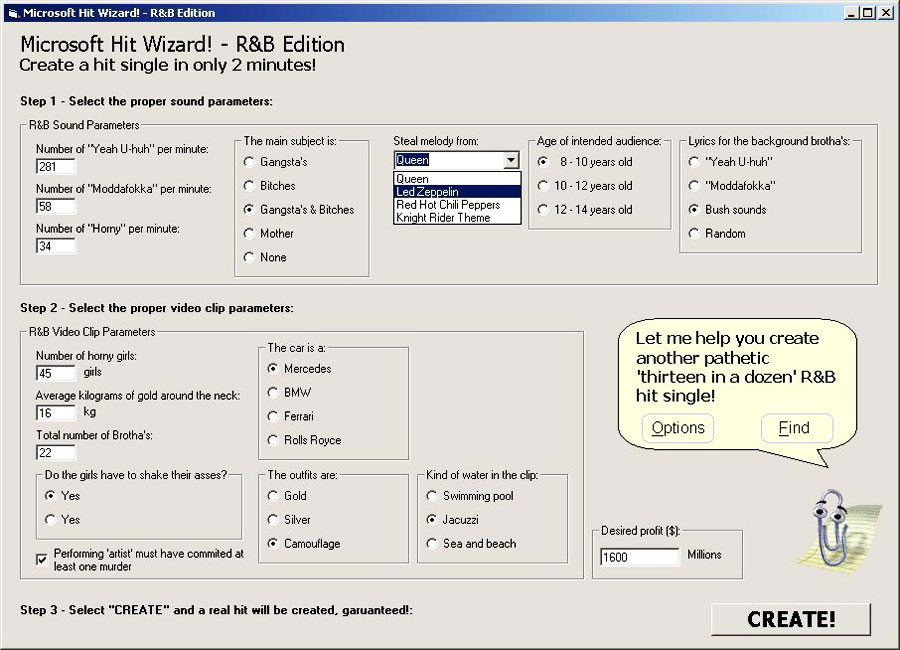
 Beispiel-Photo zum Thema „Mini-Playback-Show“
Beispiel-Photo zum Thema „Mini-Playback-Show“ Opel Olympia P1 Kombi von 1957
Opel Olympia P1 Kombi von 1957